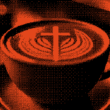„Einer der 7 Gründe, warum VR-Pornographie besser ist als Prostitution: Niemand wird geringgeschätzt. Du hast Spass und niemand wird physisch verletzt. Es ist sicherer für alle.“ Wer sich auf die Suche nach Lösungen für die jahrhundertealten Probleme der Sexarbeit macht, wird sie wohl kaum in der Pornoindustrie vermuten. Über die Arbeitsbedingungen und das problematische Bild von Sexualität in der Pornographie wurde schon zur Genüge geschrieben. Unterdrückung und Gewalt scheinen nicht etwa ungewollte Begleiterscheinungen, sondern charakteristische Merkmale zu sein. Es überrascht also, wenn man den eingangs zitierten Werbespruch ausgerechnet auf einer Pornoseite trifft.
Der Ansatz klingt verlockend: Durch die VR-Pornographie (VR steht für virtual reality) können sexuelle Dienstleistungen im virtuellen Raum stattfinden. Waren dem Erlebnis früher durch den Bildschirm Grenzen gesetzt, versprechen Anbieter von VR-Pornographie ein vollständiges Eintauchen in ein personalisiertes Abenteuer. Ganz nebenbei sei das Ganze sicher und kosteneffizient. Wer nun denkt, dass auch dem aufwändigsten und realistischsten VR-Porno immer noch natürliche Grenzen gesetzt sind, namentlich das Ausbleiben körperlicher Nähe und Berührungen, hat die Rechnung ohne die Japaner gemacht. Eine Firma, die einen haptischen Körperanzug auf den Markt gebracht hat, verspricht ihren KäuferInnen „das volle Paket sexueller Erfahrung, ganz ohne das Bedürfnis nach einem anderen Menschen“.
Auch wenn diese neuen Angebote sicherlich die hedonistische Erfahrung des Pornographiekonsums revolutionieren mögen, lösen sie die Probleme nicht. Schliesslich muss immer noch ein Schauspieler oder eine Schauspielerin vor der Kamera stehen, sich präsentieren und den Akt vollziehen. An den Arbeitsbedingungen in der Pornoindustrie ändert das neue Medium nichts. Zu behaupten, dass niemand unterdrückt oder physisch verletzt wird, ist eine zynische Verklärung der Realität – auch wenn diese virtuell ist. Nichtsdestotrotz: Die Fortschritte der Pornographie lassen immer mehr die Grenzen zwischen sexueller Unterhaltung und Sexarbeit verschwinden.
Sexarbeit in der Schweiz
„Und wie hast du’s mit der Sexarbeit?“ Diese Frage stellt sich die Schweiz immer wieder selbst. Das letzte Mal ernsthaft über ein Verbot von käuflichem Sex wurde 2013 mit einem Postulat im Nationalrat diskutiert, unterzeichnet von 43 ParlamentarierInnen aus allen politischen Lagern. Doch auch wenn dieser Versuch scheiterte: Prostitution ist in der Schweiz ein Dauerthema. „Im Vergleich zu anderen Ländern hat sich die Schweiz zwar klar gegen ein Verbot der Sexarbeit ausgesprochen“, sagt Rebecca Angelini von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) in Zürich. „Doch auch wenn sie legal ist: Sie wird stark reguliert.“
Dass ein in vielerlei Hinsicht kontroverses Gewerbe durch den Staat reguliert wird, scheint auf den ersten Blick im Interesse der Gesellschaft und der betroffenen Arbeiter*innen zu sein. Auf der einen Seite kann der Staat so Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum vorbeugen, etwa verhindern, dass PrimarschülerInnen auf ihrem Schulweg den Strassenstrich passieren müssen. Auf der anderen Seite kann er durch Auflagen für Transparenz im Dickicht der Szene sorgen und dadurch die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen verbessern.
Es überrascht also, dass sich gerade diejenigen Organisationen, die sich für die Interessen der SexarbeiterInnen einsetzen, immer wieder gegen die staatlichen Regulierungen aussprechen. So zum Beispiel Lysistrada im Kanton Solothurn. „Das Regulierungsregime der Schweiz führt zu einer Zweiklassen-Sexarbeit“, stimmt auch Angelini in die Kritik mit ein. „Zum einen gibt es die Gruppe, welche die hohen behördlichen Hürden bewältigen und legal arbeiten können. Zum anderen gibt es aber eine grosse Gruppe, die durch diese in den Untergrund getrieben werden. So funktionieren die Regulierungen als eine Art Mechanismus der Kriminalisierung durch die Hintertür.“
Es ist genau diese zweite Gruppe, welche die Sozialwissenschaftlerin Angelini als die verletzlichsten Sexarbeiter*innen identifiziert. Verschärft der Staat zum Beispiel die baulichen Anforderungen an Kleinclubs (meist ein oder zwei Zimmer betrieben durch eine Sexarbeiterin), können sich viele Frauen einen Umbau nicht leisten. Aber es sind längst nicht nur bauliche Massnahmen, die das Leben der Sexarbeiter*innen erschweren. Zum Beispiel macht in der Stadt Zürich die Bau- und Zonenordnung das Führen eines sexgewerblichen Salons in Zonen mit 50% oder mehr Wohnanteil schwierig. Das Bewilligungsverfahren ist ohne teuren Anwalt oft nicht durchführbar. Die behördlichen Massnahmen stehen dabei nicht im luftleeren Raum, sondern werden durch Kontroll- und Sanktionsinstrumente begleitet. „So geraten die Sexarbeiter*innen durch die behördlichen Regelungen in neue Abhängigkeiten, denn es findet eine Verschiebung aus den selbstständigen Kleinclubs hin zu Grossklubs, in die Illegalität oder in die Sozialhilfe statt“, sagt Angelini. Neue Regulierungen würden zwar als Verbesserung verkauft, erwiesen sich aber meist als neue Repressionsmittel.
Was wollen wir für eine Sexarbeit?
Diese Kritik der Organisationen, welche sich aktiv für die Interessen von Sexarbeiter*innen einsetzen, öffnet einen völlig neuen Blick auf die Diskussion. Es scheint, als hätte sich die Schweiz zwar für die Legalität entschieden, als sei man sich aber gleichzeitig über das Wesen der helvetischen Sexarbeit nicht im Klaren. Vielleicht liegt das daran, dass die Diskussionen um die Sexarbeit kontrovers und vielschichtig sind. Sie lässt sich nicht in den klassischen Konfliktparadigmen sonstiger politischer Diskussionen verstehen.
So ringen etwa FeministInnen untereinander über das Wesen der Sexarbeit. Auf der einen Seite steht die Kritik, dass die weibliche Sexualität nur als Dienstleistung behandelt wird, und dass eine staatliche Akzeptanz diesem Verständnis seine Legitimität verschafft. Ausserdem wird Prostitution oft in Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen* und mit Menschenhandel gebracht. Auf der anderen Seite ist es aus liberaler Sicht schwer zu argumentieren, warum der Staat das Recht haben soll, Frauen* die Ausübung ihrer Sexualität zu regulieren. Dies wäre ein massiver staatlicher Eingriff in die Integrität der Körper der Frauen*, die sich für Sexarbeit interessieren würden. Auch kann die selbstbestimmte Sexarbeit auf individueller Ebene durchaus als Emanzipation von gesamtgesellschaftlich zementierten Geschlechterhierarchien und Sexismus gesehen werden.
Oft wird das Bild der selbstbestimmten Sexarbeiter*in als Ideal bemüht. Aber gerade in Anbetracht der feministischen Kritik der Sexarbeit stellt sich die Frage, was selbstbestimmt unter diesen von FeministInnen erwähnten Begleiterscheinungen überhaupt bedeuten kann. „Die Frage ist doch, welche Arbeit überhaupt im Kapitalismus selbstbestimmt ausgeführt wird“, hält Angelini entgegen. „In unserer durch Ungleichheit geprägten Gesellschaft verengen Geschlechterhierarchien, Armutsgefälle und Rassismus die Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Auch aufgrund der hiesigen Migrationsgesetze. Und das nicht nur in der Sexarbeit”, wie die Sozialwissenschaftlerin feststellt. Die Möglichkeiten für Migrant*innen, welche den grössten Teil der Schweizer Sexarbeiter*innen ausmachen, seien stark beschränkt. „Und unter diesen Voraussetzungen treffen tatsächlich viele Frauen* den selbstbestimmten Entscheid für die Sexarbeit.“ Andere wiederum würden sich zum Beispiel als Reinigungskraft oder in der Care-Arbeit versuchen.
Wir haben es also mit einer mehrheitlich selbstbestimmten Sexarbeit in der Schweiz zu tun, die erwähnten Probleme des schweizerischen Asylsystems in Zusammenhang mit Menschenhandel einmal ausgeschlossen. Ein positiver Befund, oder? Doch die Definition einer selbstbestimmten Sexarbeiter*in ist eng gesteckt. Ein bewusster Entscheid für den Beruf, die Möglichkeit aufzuhören und die Wahlfreiheit über Angebot, Klientel und Verhütung: Mehr braucht es nicht, um als selbstbestimmt zu gelten. So betrachtet relativiert sich der positive Befund: Selbstbestimmung ist ein wichtiger Faktor, doch konstituiert sie alleine kein menschenwürdiges Dasein. Rechnet man dann noch die negativen Effekte der behördlichen Massnahmen in die Gleichung mit ein, vervollständigt sich das Bild der Sexarbeit als prekäres Berufsfeld.
Digitalisierung in der Sexarbeit: Bahnt sich eine Revolution an?
Wie die anfangs erwähnten Beispiele gezeigt haben, kann die Pornographie getrost als einer der Motoren der Digitalisierung verstanden werden. Noch bevor Netflix überhaupt zur grössten virtuellen Videothek wurde, konnten pornographische Inhalte in überraschender Geschwindigkeit gestreamt werden. Während andere Entertainmentsparten sich in der virtuellen Realität erst noch zurechtfinden müssen, haben gewiefte Firmen bereits mit der Produktion von erster Virtual-Reality-Avatar-Pornographie begonnen. Die Pornographie hat sich also unterdessen von der Wandmalerei in die virtuelle Realität vorgekämpft und hat es nun auf die Sexarbeit abgesehen.
Könnte es tatsächlich der Fall sein, dass die Sexarbeit durch die digitalen Neuerungen ersetzt wird – und damit auch ein Teil ihrer Probleme? Die Sexarbeit ist über die Jahrhunderte, mal abgesehen von Lebensumständen und rechtlichem Status, relativ stabil in der analogen Welt verblieben. „Es wird immer neue Angebote geben, aber diese werden die Sexarbeit niemals ersetzen“, ist Angelini überzeugt. „Sexarbeit ist nicht nur der sexuelle Akt, sondern das ganze Erlebnis. Diese soziale Komponente kann nicht simuliert werden.“ Die Sozialwissenschaftlerin von der FIZ ist nicht allein mit ihrer Gelassenheit gegenüber der Digitalisierung: Auch Sexarbeiter*innen sehen ihre Berufsgruppe durch VR-Pornographie nicht bedroht.
Dies ist sicherlich ein positiver Befund für viele Sexarbeiter*innen, die sich somit keine Sorge um ihre berufliche Zukunft machen müssen. Allerdings wird auch klar, dass die VR-Pornographie somit nichts an den prekären Lebensumständen der Sexarbeiter*innen ändern wird.
„Gingr“ – eine Art Uber für die Sexarbeit
Einen anderen Weg der Digitalisierung in der Sexarbeit geht das Zürcher Startup-Unternehmen Gingr. Die Firma hat es sich zum Ziel gemacht, die Vermittlung zwischen Sexarbeiter*in und Freier zu vereinfachen. Präsentation, Auswahl, Kontaktaufnahme und Buchungsprozess: Alles ist über die Smartphone-App zentralisiert. Laut eigenen Angaben finden über die Plattform 200 bis 500 „Transaktionen“ pro Tag statt – Tendenz steigend.
Nun ist eine App, die es Sexarbeiter*innen ermöglicht, online Inserate aufzuschalten, nicht gerade revolutionär. Doch die App, die sich bis vor kurzem in der Beta-Phase befand, hat einen kleinen Twist: Nicht nur ist sie mit einer Ortungsfunktion ausgestattet, welche dem Freier erlaubt, die am nächsten gelegene Sexarbeiter*in aufzusuchen, sondern sie hat auch ein interessantes Bewertungssystem. Wie Gingr-Gründer Sergio Rigert bereits in einem Artikel bei Watson angekündigt hat, sollen auf seiner App nicht nur die Freier die Sexarbeiter*innen bewerten können, sondern auch umgekehrt. Diese Bewertung sollte dann für andere Sexarbeiter*innen ersichtlich sein. So könnten sie aufgrund der Bewertung entscheiden, ob sie mit dem Freier überhaupt in Kontakt treten wollen.
Diese umgekehrte Dynamik hat tatsächlich ihren Reiz. Zwar wird die weibliche Sexualität auch hier als reine Dienstleistung verstanden, doch immerhin muss sich nicht nur die Sexarbeiter*in, sondern auch der Freier in einem guten Licht präsentieren. Theoretisch findet tatsächlich eine Angleichung statt, wenn auch nur eine kleine. Aber die gesellschaftlichen Ungleichheiten bleiben weiterhin bestehen. Einer selbstbestimmten Sexarbeiter*in machen die behördlichen Massnahmen auch auf Gingr einen Strich durch die Rechnung. Das sieht man nicht zuletzt am relativ hohen Anteil an Bordellen und Grossclubs auf der Plattform. Ausserdem ist es illusorisch zu glauben, dass es sich eine Sexarbeiter*in lange leisten kann, Freier mit schlechten Bewertungen abzulehnen.
Wenn sich also an den gesellschaftlichen Dynamiken nichts ändert, dann wird auch Gingr die Lebensbedingungen der Sexarbeiter*innen nicht verbessern. Wie es bereits die Diskussionen um Uber gezeigt haben: Stimmt der rechtsstaatliche Kontext nicht, können solche neuen Angebote am System nichts ändern. Im schlimmsten Fall akzentuieren sie gesellschaftliche Probleme sogar.
Analoge Revolution der Sexarbeit
Die Digitalisierung wird den Marktzugang erleichtern und die Angebotsvielfalt in der Sexarbeit erhöhen. Aber sie wird sie nicht revolutionieren: Zu komplex ist das menschliche Verlangen nach Nähe, zu vielschichtig die Dienstleistungen, die Sexarbeiter*innen anbieten. Ihre Lebensbedingungen sind aufgrund der regulierten Legalität in der Schweiz schwierig, oft sogar prekär. Daran werden Angebote wie Gingr und VR wenig ändern.
Gerade aber diese prekären Lebensbedingungen gehen nicht einher mit dem postulierten Grundsatz, dass „Sexarbeit in der Schweiz legal“ sei. Legalität ist ein erster Schritt. Doch ist sie in ein patriarchisches, von ökonomischen Ungleichheiten geprägtes System eingegliedert, kann dies unerwünschte Folgen haben. Die gesellschaftlichen Dynamiken spiegeln sich und werden durch die strengen behördlichen Massnahmen verstärkt. Und dies kann in niemandes Interesse sein. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sollte als Richtschnur der Digitalisierung gelten – auch, oder vor allem, in einem Berufsfeld wie der Sexarbeit. Viel wichtiger ist aber, dass sie als Leitlinie behördlicher Massnahmen gilt. Denn nur wenn Behörden den vorhandenen gesellschaftlichen Dynamiken Gegensteuer bieten, kann die Sexarbeit tatsächlich revolutioniert werden – ganz ohne Smartphone und VR-Brille.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?