„Die schlechte Gewohnheit” von Alana S. Portero. Ein Tipp von Melina.
In Alana S. Porteros autofiktivem Debütroman begeben wir uns in Madrids Peripherie der 80er- und 90er-Jahre. San Blas ist ein im Osten der Hauptstadt liegender Stadtteil, der von Armut und Zerfall durchzogen ist und dessen Bewohner*innen von der Regierung als Plage abgetan werden, die es zu beseitigen gilt. Dies geschieht durch eine fast geschenkte Heroin-Zufuhr, die für viele der dort lebenden Arbeiter*innen und deren Kinder einem Todesurteil gleichkommt.
Beim Lesen wird immer deutlicher, was es heisst, in einer Gesellschaft zu leben, die die eigene Existenz hinterfragt oder gar ablehnt.
Inmitten dieser Kulisse wächst die Protagonistin des Romans auf. Schon von klein auf soll sie ein „ganzer Kerl” sein – jedoch bemerkt sie schon früh, dass sie ein Mädchen ist, dass sie trans ist. Sie lernt, dass sie zum Schutz ihrer selbst die Fassade aufrechterhalten muss und ihre Tanzeinlagen zu Madonna-Songs niemanden sehen lassen darf. Die Erzählerin gibt sich nur wenigen Menschen zu erkennen, die ihren Weg kreuzen, und es sind auch deren Geschichten, die sie dazu ermahnen, sich nicht unter dieser Maske ersticken zu lassen.
Portero beschreibt dieses Milieu und dessen Bewohner*innen mit all ihren Widersprüchlichkeiten. Sie lässt uns an der Solidarität unter den Menschen des Viertels, die von einem gemeinsamen Klassenbewusstsein geprägt sind, teilhaben. Gleichzeitig beschönigt die Autorin in keiner Weise die Gewalt, die queere Menschen erfahren, und schildert schmerzhaft deren Ausgrenzung aus der Gemeinschaft. Die Spaltung, die die Erzählerin in ihrem Inneren und Äusseren, bei Tag und Nacht und den unterschiedlichen Personen in ihrem Leben vollziehen muss, wird uns beim Lesen immer deutlicher – und damit auch was es heisst, in einer Gesellschaft zu leben, die die eigene Existenz hinterfragt oder gar ablehnt.
Alana S. Portero ist nebst Autorin und Aktivistin auch Dramatikerin, was sie uns bereits in der ersten Szene im Buch vermuten lassen lässt. Sie besitzt die Fähigkeit, Szenarien nicht nur zu erschaffen, sondern sie bis zum bitter-schönen Ende lebendig werden zu lassen.
Die Figuren in ihrem Buch zeichnet die Autorin gekonnt mit all ihren Nuancen und verfängt sich nicht im Kitsch des Leides der Charaktere. So gelingt es ihr auch, diese nicht zu Stereotypen verkommen zu lassen.
Zwischen viel Gewalt und Leid wird das Schöne und das Menschliche subtil hervorgehoben und lässt eine*n das Buch, trotz allem, mit einem hoffnungsvollen Gefühl schliessen.
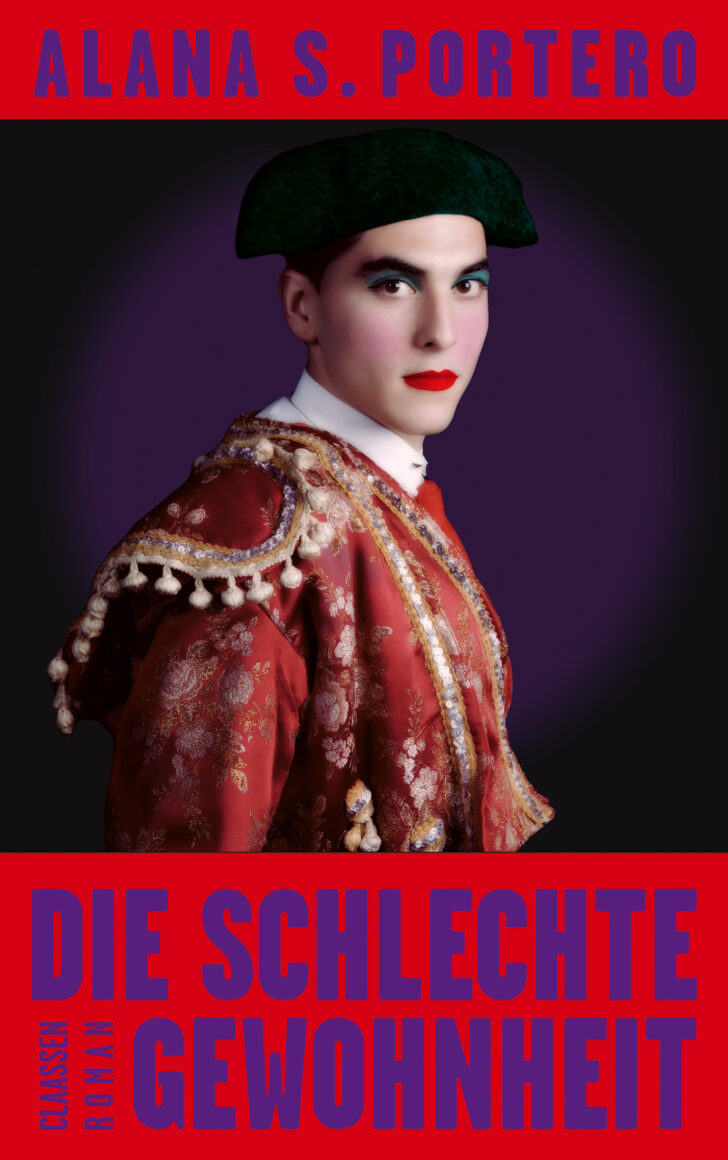
Alana S. Portero: Die schlechte Gewohnheit. Ullstein, März 2024, S. 240.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt bei ihnen an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
„Re:claim” von Jot Vetter. Ein Tipp von Auline.
Ein Comic in Zürichs naher Zukunft – bestens unterhaltsam und wunderbar schlau! Die Wahlfamilienbande Mo, Adri Sam und zwei weitere Freund*innen leben im Kreis 5 in einem besetzten Haus und begleiten uns durch diesen schwarz-weiss illustrierten Comic.
Plötzlich liegt ein Hirschgeweih am Zürcher Bellevue.
Jot Vetter greift Franz Hohlers 1982 erschienenen Roman „Die Rückeroberung” mit Schauplatz Oerlikon neu auf. Erstaunlich ist, dass Hohler damals Orte wie die Binz für seine Erzählung in Zürich verwendete, die Jahre später zu autonomen Häusern wurden. Jot verlegt den Wohnort der Hauptcharaktere von Oerlikon in den Kreis 5 und macht aus der Kleinfamilie eine Freund*innenbande, lässt sonst aber ähnliches geschehen wie Hohler. Plötzlich liegt ein Hirschgeweih am Zürcher Bellevue – ein erstes Zeichen für eine grosse Veränderung: Die Stadt wird von Wildtieren eingenommen.
Die Geschichte ist spannend und unterhaltsam, und regt gleichzeitig zum Nachdenken an: Wem gehört der öffentliche Raum? Wem gehört die Stadt? Vor allem aber: Was sind wir der Natur schuldig und wie können wir zwischen Beton, Menschen, Pflanzen und Tieren zusammenleben?
Und: Wenn der Comic fertig gelesen ist, bieten sich die detailreichen Zeichnungen bestens zum Ausmalen an.
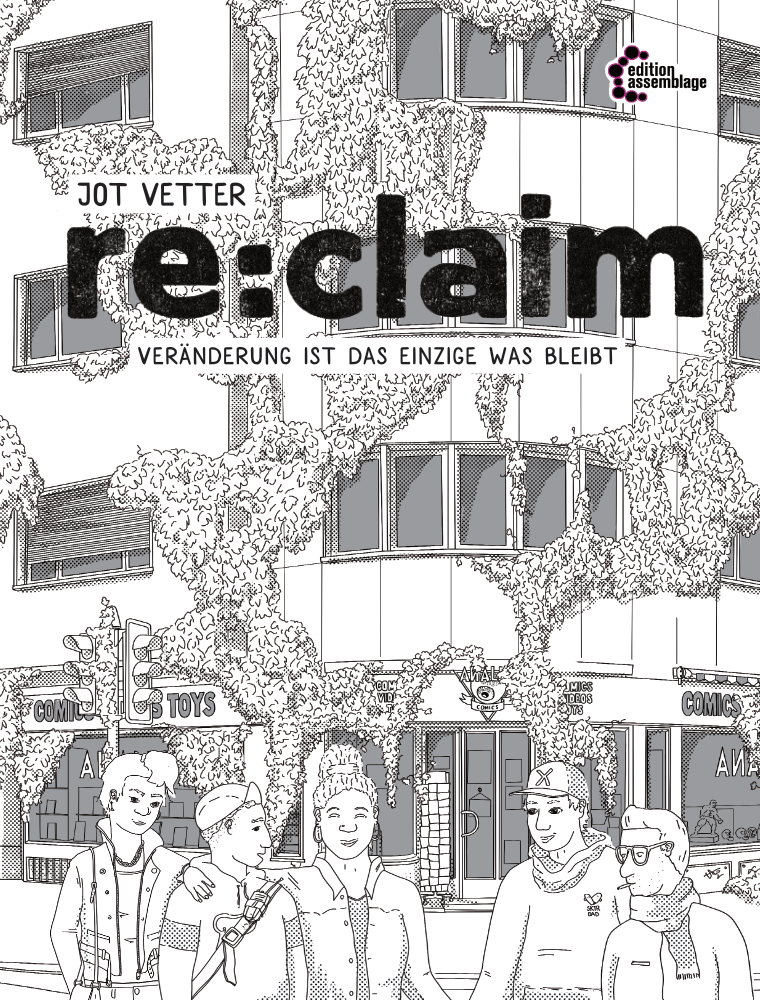
Jot Vetter: re:claim. Veränderung ist das Einzige was bleibt, edition assemblage, Mai 2024, S. 120.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt im Laden an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
„Ein schönes Ausländerkind” von Toxische Pommes. Ein Tipp von Auline.
„Toxische Pommes” ist eine österreichische Anwältin und Komikerin. Sie nimmt mit ihren Klassen-Witzen reiche Linke auf die Schippe, macht grosse Satire über die „hässlichen Seiten des Lebens” – und hat damit Erfolg: Über 200’000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Lustig, oder?! Lustig ist auch ihr erster Roman „Ein schönes Ausländerkind”, die Geschichte einer dreiköpfigen Familie, die kurz vor dem Ausbruch des Jugoslawienkriegs aus Rijeka nach Österreich migriert. Anders als andere Familien suchen sie weder Asyl, noch müssen sie als Gastarbeiter*innen zwischen Hier- und Dortsein wechseln. Die zweijährige Tochter und ihre Eltern finden bei Renate Hell und deren Familie einen Wohnort.
Doch die Kosten sind hoch: Die Mutter der Ich-Erzählerin arbeitet als Haushälterin und Kinderfrau für Familie Hell und wird im Haus ihrer eigenen Familie nur noch müde bis erschöpft auf dem Sofa gesehen. Renate Hell, Helferin und Grosszügige, hat in ihrem Hinterhäuschen diese Frau aufgenommen, die pausenlos für sie da sein soll. Auch als Freundin wird die Mutter benutzt, mit Renate soll sie im Keller Zigaretten rauchen und stundenlang zuhören, was die gütige Dame sonst mit niemandem bereden kann.
Die Fremdenfeindlichkeit wird so subtil beschrieben, wie sie sich für die Ich-Erzählerin vorerst anfühlt.
Der Vater der Ich-Erzählerin langweilt sich zeitgleich in die Depression, die natürlich nie als solche benannt wird. Beklagen soll man sich ja nicht. Täglich putzt er das eigene Häuschen stundenlang, kocht und isst mit seiner Tochter, begleitet sie überall hin, fördert sie, unterstützt sie. Er hat keine Arbeitsbewilligung und kein Geld für eine andere Beschäftigung, vor der Tür geht er gebückt durch die Strassen und spricht fast kein Wort.
Die Fremdenfeindlichkeit wird so subtil beschrieben, wie sie sich für die Ich-Erzählerin vorerst anfühlt. Doch mit den Jahren wird sie nicht nur älter, sondern auch wütender. Sie setzt alles daran, das perfekte Migrant*innenkind zu sein, schreibt Bestnoten in der Schule und auch im Schwimmclub ist sie vorne mit dabei. Erst später wird sie merken, dass ihre Eltern ihr eigenes Leben für sie aufgeben. Vorerst ist sie nur wütend auf die abwesende Mutter und den ruhigen, vom neuen Internet besessenen Vater, für den sie sich schämt. Später wächst auch die Wut auf Renate Hell und das System im Allgemeinen – die Verhältnisse werden dem ehrgeizigen Kind bewusster.
Aber was ist an diesem Buch eigentlich lustig? Die Art und Weise, wie die Autorin über Verhältnisse und Situationen schreibt, bringt eine*n zum Schmunzeln. Das Geschriebene ist eher skurril und absurd als tatsächlich witzig – und dennoch von grosser Empathie und Gerechtigkeitssinn geprägt.
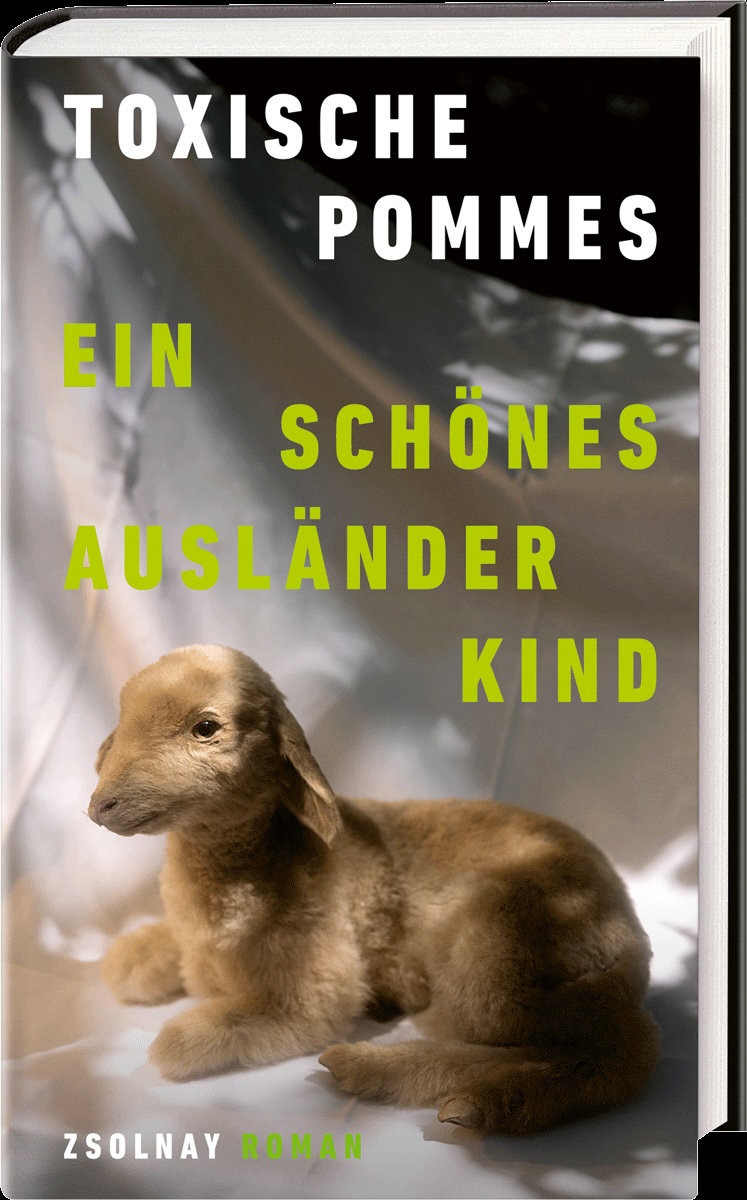
Toxische Pommes: Ein schönes Ausländerkind, Paul Zsolnay Verlag, März 2024, S. 208.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt im Laden an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
„Klarkommen” von Ilona Hartmann. Ein Tipp von Margot.
„Klarkommen” ist ein Roman über das Erwachsenwerden, über grosse Hoffnungen an eine freie Jugend, die nicht so erfüllt werden, wie man sich das erträumt hat: Liebe tut weh, das Grossstadtleben kostet mehr Geld als zur Verfügung steht und niemand wartet auf dich.
Für das Erwachsenwerden gibt es kein Skript.
Die Erzählfigur muss bitter erfahren, dass es für das Erwachsenwerden kein Skript gibt, dass es nie „erledigt” ist und auch keinen Stichtag hat. Der in kurze Kapitel gefasste Roman ist aber trotzdem tröstlich und wohltuend, denn Hartmann sucht und findet eine Sprache für all die unbehaglichen Gefühle, mit denen wir uns in unserer Jugend alleine (gelassen) fühlten.
Ein ruhiges, langsames Buch, das sich dennoch spannungsvoll liest, weil es immer wieder mit unerwarteten Wendungen und Beobachtungen überrascht und sich Leser*innen – wohl insbesondere weiblich sozialisierte – wiederfinden können.

Ilona Hartmann: Klarkommen, park x ullstein, Februar 2024, S. 192.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt im Laden an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
„Weltalltage” von Paula Fürstenberg. Ein Tipp von Auline.
Mit ihrem neuen Roman „Weltalltage” schenkt uns Paula Fürstenberg ein Buch über Freund*innenschaftskummer. Viel zu selten habe ich in Romanen tiefe Freund*innenschaft verhandelt gesehen. Max und die Ich-Erzählerin, beide mit alleinerziehenden Müttern in Ostdeutschland aufgewachsen, teilen nämlich eine beste Freund*innenschaft seit Schulzeit und auch eine gemeinsame Wohnung. Keine Angst, das Buch endet nicht in der Hetero-Norm! Das Starke am Buch ist, dass die Autorin den beiden Figuren allen Platz auch für die hässlichsten (neben all den schönen) Seiten der Freund*innenschaft lässt und man die Menschlichkeit fast schon durch die Seiten riechen kann.
„Weltalltage” ist aber nicht nur ein Buch über Freund*innenschaft, sondern auch eines über Krankheit. Max ist seit immer der gesunde Körper, Max funktioniert, bei Max läuft’s. Die Ich-Erzählerin hingegen liegt immer mal wieder tagelang im Bett, bei der Ärztin oder sitzt auf dem Stuhl der Frau Doppelname, ihrer Psychotherapeutin. Ihre Endometriosenherde wurden mittlerweile lokalisiert – nach vierzehn Jahren Schmerzen vergleichbar mit denen eines Herzinfarkts.
Trotzdem ist die Ich-Erzählerin von ihren körperlichen Problemen nicht befreit: Ihre chronische Krankheit prägt ihr Leben – die Weltalltage. An jenen Tagen leidet sie unter starkem Schwindel, ihr Körper hört auf zu funktionieren. An jenen Tagen ist Max für sie da, lebt ihr Leben mit, erledigt Dinge, die für sie allein unmöglich sind. Der funktionierende und gesunde Körper von Max bleibt zwar noch eine Weile stabil – doch Max wird immer trauriger, immer schmaler und Max’ Wesen verändert sich innerhalb eines Jahres ziemlich radikal. Immer tiefer schleicht sich die schlechte Laune in Max’ Leben und wird schliesslich zu einer düsteren Depression.
Paula Fürstenberg beschreibt die Entwicklung von Schmerz und Krankheiten präzise und findet eine Sprache für die Sprachlosigkeit und Unbeholfenheit der zwei Hauptfiguren.
„Vielleicht messen wir Freundschaft im Vergleich zu familiären und romantischen Beziehungen auch deshalb weniger Bedeutung bei, weil es so schwierig ist, sie klar zu bestimmen.”
Gewisse Kapitel steigen mit einem Zitat verschiedener Autor*innen ein, die zu Krankheit, Gesundheit und Freund*innenschaft geschrieben haben. So zum Beispiel das Zitat vom deutschen Schriftsteller und Journalisten Daniel Schreiber: „Vielleicht messen wir Freundschaft im Vergleich zu familiären und romantischen Beziehungen auch deshalb weniger Bedeutung bei, weil es so schwierig ist, sie klar zu bestimmen. Nur die Liebe kann eine grosse Erzählung für sich beanspruchen, Freundschaften gehen mit kleinen Erzählungen einher, mit unzähligen kleinen Erzählungen, die nur ungern vorgefertigten Mustern folgen.”
Literaturhinweise wie diese haben mir besonders gefallen – und das im Buch enthaltene „Pathobiografische Alphabet”. Darin bettet die Autorin Zitate und ihre Gedanken über die Werke der genannten Schriftsteller*innen in die Gedanken der Ich-Erzählerin ein. Das Buch ist nämlich auch ein Schreibprozess der Ich-Erzählerin, die versuchen will, die Freund*innenschaftsgeschichte zu verschriftlichen und einen Roman daraus machen.
Auch das führt zu einem Konflikt der beiden, denn Max will nicht, dass seine Depression benutzt wird, um einen Roman zu schreiben. Das lässt die Frage aufkommen: Wer erzählt wessen Geschichten und zu welchen Kosten?

Paula Fürstenberg: Weltalltage, Kiepenheuer & Witsch, Februar 2024, S. 320.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt im Laden an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?














