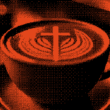Karen Hamann ist Umweltpsychologin an der Universität Koblenz-Landau und forscht zu psychologischem Empowerment von Engagierten im Umweltschutz. Sie ist Vorstandsmitglied des Wandelwerk e.V., Stipendiatin der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und Autorin der Publikation Psychologie im Umweltschutz — Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns.
das Lamm: Wie würden Sie kognitive Dissonanz in einem Satz definieren?
Karen Hamann: Kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Spannungszustand, der eintritt, wenn unser Verhalten nicht mit unseren Werten übereinstimmt bzw. wenn zwei Werte sich widersprechen.
Der Spannungszustand, der durch kognitive Dissonanz entsteht, ist unangenehm. Ist es also urmenschlich, kognitive Dissonanzen auflösen zu wollen?
Ja, das ist in der Tat so. Insbesondere, wenn Menschen im Umweltschutz mit Angstbotschaften oder starken Schuldzuweisungen konfrontiert werden. Wer sich nicht nachhaltig verhält, aber um die Bedrohung durch die Klimakatastrophe weiss, kann Schmerz verspüren. Umso mehr, wenn er oder sie darauf aufmerksam gemacht wird.
Generell gilt: Wir sollten uns in der Umweltkommunikation bewusst sein, dass Informationen über den Zustand der jetzigen Welt Schmerz auslösen, und deshalb Menschen damit nicht allein stehen lassen. Es braucht Räume, um mit dem Schmerz umgehen zu lernen und Motivation fürs Handeln zu entwickeln. Es braucht also quasi eine problemorientierte Umgangsweise mit den kognitiven Dissonanzen.
Gibt es auch Menschen, die gut und gerne mit diesen Spannungen leben?
Letztlich leben eigentlich alle Menschen mit diesen Spannungen in der ein oder anderen Form. Durch sogenannte emotionale Bewältigungsstrategien ist es uns möglich, Probleme zu ignorieren oder kleinzureden – die Spannungen also für eine gewisse Zeit zu lindern. Das sind Schutzmechanismen, die in vielen Situationen angebracht sind, in denen wir glauben, nichts tun zu können.
Zwei unterschiedliche Beispiele: Ob ich eine Mutter mit ökologischen Werten bin, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fährt oder ein Hardcore-Aktivist, der das Privileg, zu einer Universität zu gehen wahrnimmt, auch wenn er es verwerflich findet, dass dies Menschen in anderen Ländern nicht möglich ist: Die Mechanismen der kognitiven Dissonanz in diesen Situationen sind ähnlich. Wenn wir sie bei uns selbst kennen, hilft uns das, andere Menschen besser zu verstehen.
Das „Nichtwahrnehmen, Leugnen oder Abwerten von Informationen” kann gemäss Wikipedia eine Strategie zur Spannungsreduktion sein. Kann man sagen, dass auch Klimawandelleugnerinnen und ‑leugner an kognitiver Dissonanz leiden?
Das kann man meiner Meinung nach nicht so vereinfachen. Es gibt Klimawandelleugner, die von der falschen Tatsache ausgehen, dass Klimawandel nicht existiert. Dies begründet sich zum Beispiel in fehlendem Vertrauen gegenüber Politikern und Politikerinnen. Dann gibt es aber auch diejenigen Klimawandelleugner, die den Klimwandel schon als Gefahr wahrnehmen, aber seine Schnelligkeit oder Intensität leugnen.
Während der erstere Fall wahrscheinlich keine kognitive Dissonanz beinhaltet, da keine Werte in Konflikt stehen, könnte dies im zweiten Beispiel schon sein. Dort reduziert jemand Spannung, indem Information abgewertet oder umgedeutet wird. Ein weiteres Beispiel: Herr Grenz sieht abends im Fernsehen einen Beitrag über die Fridays-for-Future-Demonstrationen. Obwohl er weiss, dass der Klimawandel menschengemacht ist und derartige Werte vertritt, sagt er zu sich selbst: „Diese Jugend will immer alles sofort haben.“ Mit dieser Strategie wertet er die Informationen einer bestimmten Gruppe ab, weil es sonst bedeuten würde, dass er sein eigenes Leben ändern und seinen Werten mehr anpassen müsste.
Warum lösen viele Menschen kognitive Dissonanz mit Scheinlösungen und Ausreden? Sind die meisten Menschen so sehr getrieben von der sozialen Anerkennung durch ihr Umfeld, dass sie eigenes Fehlverhalten gegen innen und gegen aussen nicht gerne zugeben?
Ja, das Bedürfnis nach Anerkennung kann in diesen Situationen zentral sein. Jedoch würde ich die Frage anders beantworten: Sie finden Ausreden, weil es ihnen von ihrem Umfeld einfach gemacht wird. Die meisten Menschen befinden sich in einem Umfeld, wo die Soll-Norm (Meinung anderer, dass es gut ist, sich umweltschützend zu verhalten) gerade nicht mit der Ist-Norm (wie sich Menschen tatsächlich verhalten) übereinstimmt.
Wenn meine Nachbarin sich für den Kohleausstieg ausspricht, aber selbst keinen Ökostrom bezieht, beeinflusst mich das immens in meinem eigenen Verhalten. Ihr Verhalten ist dabei die beste Rechtfertigung, selbst auch inkonsistent zu sein. Inkonsistenzen in sozialen Normen spiegeln sich deshalb in unserer eigenen kognitiven Dissonanz wider – und machen es einfacher, Spannungen auszuhalten.
Die individuelle und die gesellschaftliche Ebene sind also zwei Pole, die sich gegenseitig verstärken und eine Negativspirale bilden. Ist das mit ein Grund, warum es sehr schwierig ist, aus diesem Denkmuster auszubrechen?
Grundsätzlich stimme ich Ihrer Annahme zu, dass soziale Normen es einem sehr schwer machen können, die eigenen klimaschützenden Werte in Verhalten münden zu lassen. Ich würde jedoch nicht sagen, dass die individuelle und die gesellschaftliche Ebene per se Negativspiralen bilden. Genauso können Positivspiralen einsetzen, etwa indem meine Nachbarin von ihrem Urlaub in der Region schwärmt. Wenn ich selbst diesbezüglich immer einen Druck gespürt habe, meinem Umfeld von tollen Urlauben in fernen Ländern zu berichten, nimmt dieser Druck daraufhin ab. So hilft sie mir, wertekonformer zu handeln und meiner Dissonanz mit einer Verhaltensänderung entgegenzutreten. In Deutschland ändern sich beispielsweise gerade soziale Normen als Positivspirale bei der Ernährung, weil immer mehr Menschen entscheiden, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren.
Im Interview mit dem Zeitpunkt sagen Sie: „…kognitive Dissonanz tritt dann ein, wenn ich mich entgegen meinen Werten und Überzeugungen verhalte. In diesem Fall habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder passe ich meine Werte an oder ich ändere mein Verhalten.” Nun könnte man sagen, dass Werte uns als Menschen ja definieren. Warum werden sie beim Auflösen der kognitiven Dissonanz trotzdem oft negiert?
Zum einen sind Werte nicht das einzige, worüber wir uns definieren. Zum anderen wird die kognitive Dissonanz schlüssiger, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir nicht nur einen Wert, sondern viele verschiedene Werte in uns tragen, die sich je nach Situation auch widersprechen können. Ein prominentes Beispiel ist der Konflikt zwischen der Offenheit für andere Kulturen und Umweltschutz. Der eine Wert legt lange (Flug-)Reisen nahe, der andere spricht ganz klar dagegen. Auf gesellschaftlicher Ebene zeigen sich diese Ziel- und Wertekonflikte bei den Sustainable Development Goals: Was passiert zum Beispiel, wenn das Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung sich mit dem Ziel des Wirtschaftswachstums widerspricht?
In Teil 1 dieser Artikelserie schreibt Alexandra Tiefenbacher darüber, welche Argumente Klimastreikenden und anderen verantwortungsbewussten Menschen in der Debatte um Zukunftsfähigkeit entgegengehalten werden. Beispiel: Du isst kein Fleisch? Ja, aber deine Sojaprodukte kommen ja auch aus dem Regenwald und sind keinen Deut besser. Wir erleben diese Debatte im persönlichen Leben, aber auch gerade auf Social Media sehr intensiv. Was ist die beste Strategie, würden Sie sagen, um diese Argumente zu kontern?
Es kommt ganz auf die Beziehung an, die ich zu der gegenargumentierenden Person habe. Ist es jemand, der oder die mir sehr wichtig ist, würde ich nahelegen, eine positive Beziehung aufrechtzuerhalten und die Grundbedürfnisse der anderen Person, wie etwa Anerkennung, nicht zu gefährden. Dabei kann man versuchen, die andere Person nach wie vor bedingungslos zu schätzen, während man jedoch auch deutlich macht, dass man manche ihrer Verhaltensweisen kritisiert.
Und: Auch, wenn wir in unserem direkten Umfeld nicht versuchen zu missionieren, ist doch unser umweltschützendes Verhalten auch für diese Personen ein Anker. In anderen Kontexten verweise ich gerne auf den Minderheiteneinfluss. Als Minderheit ist es wichtig, sachlich zu argumentieren und am besten andere Befürwortende zu gewinnen, die sonst für gewöhnlich eine Mehrheitsmeinung vertreten. Für das Fleisch-Beispiel heisst dies, dass ich zwei valide Quellen senden würde, die den Soja-Verbrauch für die Fleischproduktion zeigen und darstellen, dass biologisch zertifiziertes Soja in den meisten Fällen aus Europa stammt. Wir können uns jedoch darauf einstellen, dass andere Menschen daraufhin nicht sofort ihre Meinung ändern werden, denn Minderheiteneinflüsse entfalten erst langsam ihre Wirkung.
Ist das umweltschützende Verhalten zwangsweise immer ein Anker? Wie gross ist die Gefahr, dass für Menschen solche Vorbilder einfach nur moralinsaure Spassbremsen sind und in Zukunft gemieden werden? Oder dass daran Freundschaften zerbrechen?
Wenn ich der anderen Person etwas bedeute und nicht gleichzeitig immer den Zeigefinger erhebe, dann kann mein Verhalten ein klarer Anker für sie oder ihn sein. Und selbst wenn wir jemanden nicht gut kennen, stellt unser Verhalten einen Teil der wahrgenommenen Ist-Norm da. Ob man ein Vorbild sein möchte, das einen nachhaltigen Lebensstil komplett durchzieht, oder lieber eigene Inkonsistenzen behält, kann meiner Meinung nach jeder und jede für sich selbst entscheiden. Dabei ist zu beachten: Wenn man authentischer handelt, nimmt man sich selbst als wirksamer wahr und wird auch von anderen als kompetenter angesehen.
Schwieriger wird es wahrscheinlich, wenn man in einer Freundschaft gemeinsam Entscheidungen treffen möchte wie ein Urlaubsziel wählen oder sich für ein Restaurant entscheiden. Dass Freundschaften so komplett zerbrochen sind, habe ich persönlich noch nie erlebt oder mitbekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein nachhaltiger Lebensstil genauso wie andere Lebensstilveränderungen (etwa ein neues Hobby, Wohnorts- oder Jobwechsel, Kinder bekommen) die Freundschaft zu manchen Menschen schwächen und zu anderen stärken kann.
In Ihrer Forschung untersuchen Sie Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wie können diese helfen, kognitive Dissonanz durch das Verändern der Handlungen aufzulösen?
Einer der Gründe, warum Menschen lieber den Klimawandel kleinreden statt ihr Verhalten zu ändern oder auf die Strasse zu gehen, ist der fehlende Glaube daran, dass sie etwas bewirken können. Deshalb liegt ein Schlüssel zu umweltschützendem Handeln in der Selbstwirksamkeit. Konkret heisst dies: Statt immer mehr Probleme müssen wir an Menschen Lösungen herantragen, die ihnen machbar scheinen. Auch das Handeln in einer Gruppe — wie etwa in einem Demonstrationszug, in der Schule oder mit der Familie — kann die Annahme stärken, etwas bewegen zu können.
Was wären andere Möglichkeiten, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln?
Der wohl wichtigste Einfluss für Selbstwirksamkeit sind Erfolgserlebnisse. Wenn wir etwas schaffen, zum Beispiel erfolgreich Gemüse anzubauen, bringt uns dies nicht nur Freunde, sondern auch den Glauben daran, etwas bewirken zu können. Ein anderes Beispiel wären Proteste, durch die dann wirklich politische Entscheidungen getroffen werden, wie wir es etwa in der Anti-Atom-Bewegung gesehen haben. Deshalb ist es essenziell, dass wir gesellschaftliche Räume schaffen, in denen Menschen diese Art von positivem Feedback bekommen. Weil es jedoch im privaten Umweltschutz oft schwierig ist, die ökologischen Konsequenzen sichtbar zu machen, ist hier insbesondere soziales Feedback relevant. Anderen für ihre klimaschützenden Bemühungen Anerkennung zu schenken und ihnen aufmerksam zuzuhören, verstärkt so weitere Verhaltensänderungen. Auch stellvertretende Erfolgserlebnisse, zum Beispiel ein Best-Practice-Beispiel der autofreien Innenstadt aus einer anderen Stadt als meiner, und die bereits erwähnten Ist-Normen (wenn sie in eine umweltschützende Richtung weisen) können Selbstwirksamkeit fördern.
Momentan ist aber die Forschung zu den Vorbedingungen von Selbstwirksamkeit im Umweltschutz noch am Anfang – genau aus diesem Grund schreibe ich darüber meine Doktorarbeit. Aus meiner eigenen Forschung ergeben sich noch weitere Vorbedingungen wie spezifisches Wissen und Kompetenzen, Wahrnehmung von Schneeballeffekten oder die Vision einer sozial-ökologisch orientierten Gesellschaft.
Ich erlebe in Diskussionen oft, dass wir beispielweise auf das Thema Urlaub kommen und es sich dann zufälligerweise herausstellt, dass ich mit dem Zug in die Ferien gefahren bin. Oft spüre ich dann, dass sich mein Gegenüber „schuldig” fühlt und das Gefühl hat, es müsse jetzt seinen Europaflug rechtfertigen. Obwohl dieses Moralisieren eigentlich nicht meine Absicht war. Was kann man in diesen Situationen besser machen?
Auch wenn dieser Zustand für Sie unangenehm ist, kann er sinnvoll sein. Allein Ihr Verhalten führt dabei nämlich dazu, dass die kognitive Dissonanz der anderen Person aktiviert wird. In Gesprächen wird die Person dann wahrscheinlich versuchen, diese Spannung wieder zu reduzieren, indem sie das Problem kleinredet oder darauf hinweist, was sie schon alles tut. Ich würde in dieser Situation deshalb der anderen Person deutlich machen, dass ich sie als Person so oder so schätze, aber im gleichen Zug ganz klar bei der Meinung bleiben, dass mein eigenes Verhalten das für mich moralisch richtige ist.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?