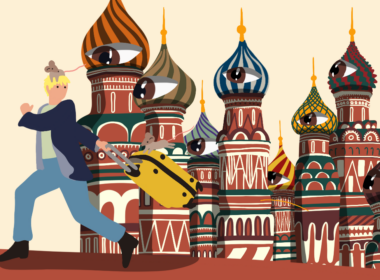Die 80-jährige Yuliya Vasilevna Horuzhevskaya wohnt in Luhanske, einem kleinen Dorf im Osten der Ukraine, nahe der Front, wo schon seit 2014 Krieg herrscht. Sie tischt Knoblauchbrote auf, erzählt aus dem Leben, von ihren Liebschaften und ihren Kartoffeln – angeblich die besten im ganzen Land –, dann meint sie: „Mag diesen Krieg gewinnen, wer will, Hauptsache, er hört auf.” Das war im Jahr 2019.
Drei Jahre später marschieren Putins Truppen in die Ukraine ein. Seit dem Angriff vom 24. Februar 2022 wurden Tausende Menschen getötet, Zehntausende verletzt und mehrere Millionen vertrieben. Viele sind in Panik, alle in Sorge: um sich selbst, ihre Liebsten, ihr Land. Die Anteilnahme und Solidarität in anderen Ländern ist gross, ebenso das Entsetzen über diesen Angriff.
Dabei herrscht in der Ukraine nicht erst seit diesem 24. Februar Krieg. Nach den Maidan-Protesten im November 2013 in Kyjiw nahm Wladimir Putin im März 2014 die Halbinsel Krim ein und sicherte den prorussischen Separatisten im Donbas im Osten der Ukraine seine bedingungslose Unterstützung zu. Daraufhin besetzten diese die Gebiete um Donezk und Luhanske und riefen sie als unabhängige Volksrepubliken aus. Als Reaktion darauf schickte die ukrainische Regierung ihr Militär in die Ostukraine. Der Krieg trieb 1,5 Millionen Menschen in die Flucht und forderte 13’000 Tote – die Opfer der letzten Wochen nicht mitgezählt.
Im Reden über den Krieg gehen die Menschen im Krieg meist vergessen. Oder sie werden zu einem stummen Kollektiv. Wie oft ist dieser Tage etwa von „den Russen” die Rede, wo man eigentlich einen Machtführer oder ein politisches Regime meint, das wieder einmal das Völkerrecht bricht?
Zugehörigkeiten fallen leichter, wenn man die Menschen – als einzelne – aus dem Blick nimmt. Auch davon ist jetzt wieder zu hören: von einem Kampf zwischen „Ost” und „West”, von einem Angriff auf „Europa”. Damit ist keine geografische Zuordnung gemeint, sondern ein „wir” gegen die „anderen”.
Dabei laufen Solidaritätsbekundungen, die auf einem „wir gegen sie” bauen, letztlich Gefahr, Kriegstreiber wie Putin in dem zu bestärken, was sie sowieso am besten beherrschen: im Spiel mit Feindbildern, die sich in den Köpfen der eigenen Leute einnisten und den anderen alles Menschliche nehmen sollen. Das erleichtert die Kriegsführung.
Teil 1: Die Schützengräben von Schachta Butowka
13’000 Tote hat der Ukraine-Krieg seit 2014 gefordert, unter ihnen sind mindestens 3’300 Zivilist*innen – die Opfer seit dem russischen Angriff im Februar 2022 nicht einberechnet. Das Unheil war all die Jahre sichtbar und für die Menschen im Osten des Landes allgegenwärtig: Checkpoints, Schützengräben wie aus vergangenen Zeiten, zerschossene Gebäude, zerstörte Strassen, vermintes Land.
Evgeni, ein ukrainischer Soldat, sprach bereits im Herbst 2019 von einem Stellungskrieg, einem sinnlosen Krieg, der nur Geld und Menschenleben koste. Von der patriotischen Euphorie und Unterstützung der Ukrainer*innen zu Beginn des Krieges sei nicht viel übriggeblieben. Kyjiw liegt 700 Kilometer im Westen von Awdijiwka, wo Evgeni ausharrt. Und auch sonst sei die Hauptstadt des Landes in den Köpfen der Leute hier im Osten weit weg, sagt der Soldat. Enttäuschung liegt in seiner Stimme.
Drei Jahre später, im März 2022, ist Evgeni noch immer an der Front und in einem neuen Krieg, von dem er sagt: „Russland ist mächtig, die Ukraine ist glorreich.”









Teil 2: Die einsamen Häuser von Katerinivka
Viktors Haus ist ein Häuschen. In der Küche, braune Tapete mit Girlanden an der Wand, steht ein Schrank und ein Tisch mit einer Mikrowelle, daneben ein Becken mit einer Zahnbürste im Plastikglas und einem Spiegel, an der Decke eine Glühbirne, die modriges Licht verbreitet. Das wenige ist an seinem Platz und das Wohnzimmer herausgeputzt, als stünde das Haus zum Verkauf. Oder als würde hier keiner leben.
Jeden Morgen, zählt der müde Mann aus Katerinovka auf, füttert er als Erstes seinen alten Hund, dann macht er die Wohnung sauber, arbeitet im Garten, raucht, trinkt ein Gläschen oder zwei, drei, isst, schläft, das ist alles. Fast sein ganzes Leben arbeitete Viktor in verschiedenen Kohlefabriken bei Luhanske. Der Lohn war nicht üppig, doch er musste sich um nichts kümmern, konnte Frau und Kind ernähren. Und dann? „Verdammt sei dieser Krieg, er hat uns alles genommen”, murrt Viktor, der nur dann redet, wenn man ihn fragt.





Teil 3: Der Fotograf aus Stanyzja Luhanska
Sie könnte aus einer Zarenfamilie stammen, er ist Fotograf, angeblich der älteste im Land. Früher war er ein Diener der deutschen Volksarmee, nun ist er alt und in Sorge: Alexander Ivanowitsch, 78, und seine Frau Valentina Pawlowa, 65, wohnen in einer von Raketen und Panzern vernarbten Strasse in Stanyzja Luhanska. Diese liegt fünf Kilometer vom Separatistengebiet entfernt, 25 Kilometer von der russischen Grenze.
Als die Separatisten kamen und nicht mehr aufhören wollten zu feuern, mussten sie sich wochenlang in einem Bunker verstecken. Zurück zuhause hatte das Dach ein Loch, die Wand zum Wohnzimmer war zerschossen. Hier hat sich Alexander sein Fotostudio eingerichtet, zwei Aufsteckblitze stehen im Raum, ein Drucker, eine verbeulte Kamera und eine neuere, an den Wänden kleben grosse, schiefe Schatten.
„Jeder Mensch hat nur ein Vaterland und meines ist die Ukraine, denn hier ist unsere Tochter geboren”, sagt Alexander, der nervös von einem Fuss auf den anderen tritt. Über Nacht sei sie ergraut, aus Angst vor den Gewehren, flüstert Valentina, heute lebe sie in Russland und alles sei gut.
Um Aufträge kümmert sich Alexander kaum noch, manchmal kommen Schulkinder, Politiker*innen oder Pärchen vorbei, sie möchten ein Hochzeitsbild. Auch im Krieg werde geheiratet, sagt Alexander, dem Himmel sei Dank.






Teil 4: Krieg ohne Ende
Mit Politik, sagt Yuliya Vasilevna Horuzhevskaya aus dem Dörfchen Luhanske an der Frontlinie, habe sie nichts zu tun. Die Menschen im Donbas hätten sich daran gewöhnt, dass andere über ihr Los entscheiden: Zaren, Oligarchen, der liebe Gott. Ohnehin kommt Yuliya von hier nicht mehr fort. Wohin sollte sie denn gehen? In die Nachbardörfer, ein paar Kilometer weiter weg von den Schützengräben? In die grossen Städte? Hier hat die alte Frau wenigstens ein Dach über dem Kopf, einen Garten, die übriggebliebenen Menschen aus dem Ort – vielleicht noch um die tausend –, die sie ihr Leben lang schon kennt.
Doch das sind schwere Gedanken. Lieber erinnert sich Yuliya an früher, als Tochter und Enkel noch bei ihr waren. Dann redet sie über Stalingrad, verbrannte Kinder, einen Liebhaber aus Sankt Petersburg, der sie partout heiraten wollte vor vierzig Jahren und über ihre Kartoffeln, die besten im ganzen Land. Manchmal hält Yuliya inne und weint und wimmert wie ein kleines Mädchen, ein andermal kann sie sich kaum halten vor Lachen, dann leuchten die Augen dieser alten Frau, die so charmant ist und verwirrt zugleich.
Einmal, erzählt Yuliya, sei sie draussen im Garten gewesen, um nach Kartoffeln zu graben, da fand sie eine Mine. Vielleicht wollen die ja gar nicht, dass wir uns Kartoffeln braten, dachte sie und grub weiter. „Wenn sie mich töten wollen, dann töten sie mich halt.”






Teil 5: Der lange Weg nach Stanyzja Luhanska
Einmal im Monat nehmen die älteren Bewohner*innen die Brücke über den Grenzfluss Siwerskji Donez nach Stanyzja Luhanska, die einzigen Passage zwischen Separatistenterritorium und ukrainischem Regierungsgebiet, um ihre Rente zu holen. Denn von den Separatisten bekommen sie kein Geld. Und von der Ukraine nur, wenn sie es auf ihrem Grund und Boden abholen: Umgerechnet im Schnitt 80 Franken pro Monat. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte, kaum an der Macht, die Ausgaben für Soziales gekürzt, von 2,7 Milliarden Franken in 2019 auf 2,3 Milliarden für 2020. Zu spüren kriegen das auch die Rentner:innen.
Hinter dem Kontrollposten warten Taxis und Kleinbusse, die die Alten zu den Bankautomaten in Stanyzja Luhanska bringen. Oder zu Bekannten von Bekannten, die ihnen ein Zimmer vermieten, 100 Griwna oder vier Franken pro Nacht, falls sie es nicht mehr schaffen, am selben Tag zurück nach Luhanske zu gelangen.
Der Weg zurück ist beschwerlich und bedarf Zeit. An den Checkpoints vergehen Stunden, Soldaten durchwühlen die Taschen, sie prüfen Ausweis und Passierschein. Zum Glück gibt es überdachte Sitzbänke gegen die Sommersonne, stabile Zelte gegen den rauen Wind und das Schneegestöber, Toiletten für alle Jahreszeiten, einen Rollstuhl für die Gebrechlichsten.
Hinter dem Kontrollposten stellen sich Frauen und Männer in Reih und Glied, sie warten auf den Bus, drängeln sich hinein, als gelte es, dem Schicksal zu entkommen. Dabei wollen sie doch bloss nicht diese 800 Meter laufen müssen hinüber bis zur Brücke, an deren Ende die Separatisten warten.





Teil 6: Die Krähen von Kramatorsk
Wie anmassend, eine Stadt beschreiben zu wollen. Sie hat viele Gesichter, keines ist ihres. Viele Gerüche, viele Wunder, viele Wetter. Kramatorsk jedenfalls, 150’000 Bewohner*innen, hat viele neue Strassen. Und Parks mit Statuen, Hampelmännern, Karussells und polierten Panzern. Sushibars und bemalte Häuser mit Blumen, Gladiatoren und Windrädern auf den Fassaden.
Und gewiss hat Kramatorsk viele Hunde, die irgendwo begraben liegen. Bars, in denen die Jugend fliessend Englisch spricht. Im April 2014 fielen prorussische Separatisten in Kramatorsk ein, im Juli war die Stadt wieder in den Händen der ukrainischen Armee, im Oktober wurde sie provisorisches Zentrum der Region. Fortan hatte man hier mächtig investiert, die Schornsteine der Stahlindustrie und der Kohlebergwerke begannen von Neuem zu rauchen.
Tagsüber sind die Strassen von Kramatorsk leer, die Männer arbeiten in den Fabriken, die Taxifahrer dösen, die Frauen gehen zum Markt und über der Stadt kreisen und krächzen die Krähen. Abends sitzen die Jungen in den Bars. Krieg? Doch nicht bei uns, sagten sie vor drei Jahren, keine 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Im April dieses Jahres wurde Kramatorsk wieder von Raketen getroffen.







Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?