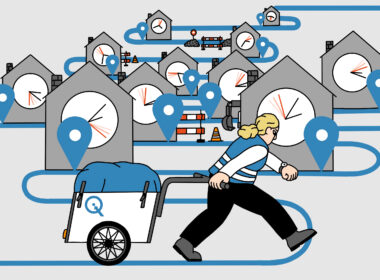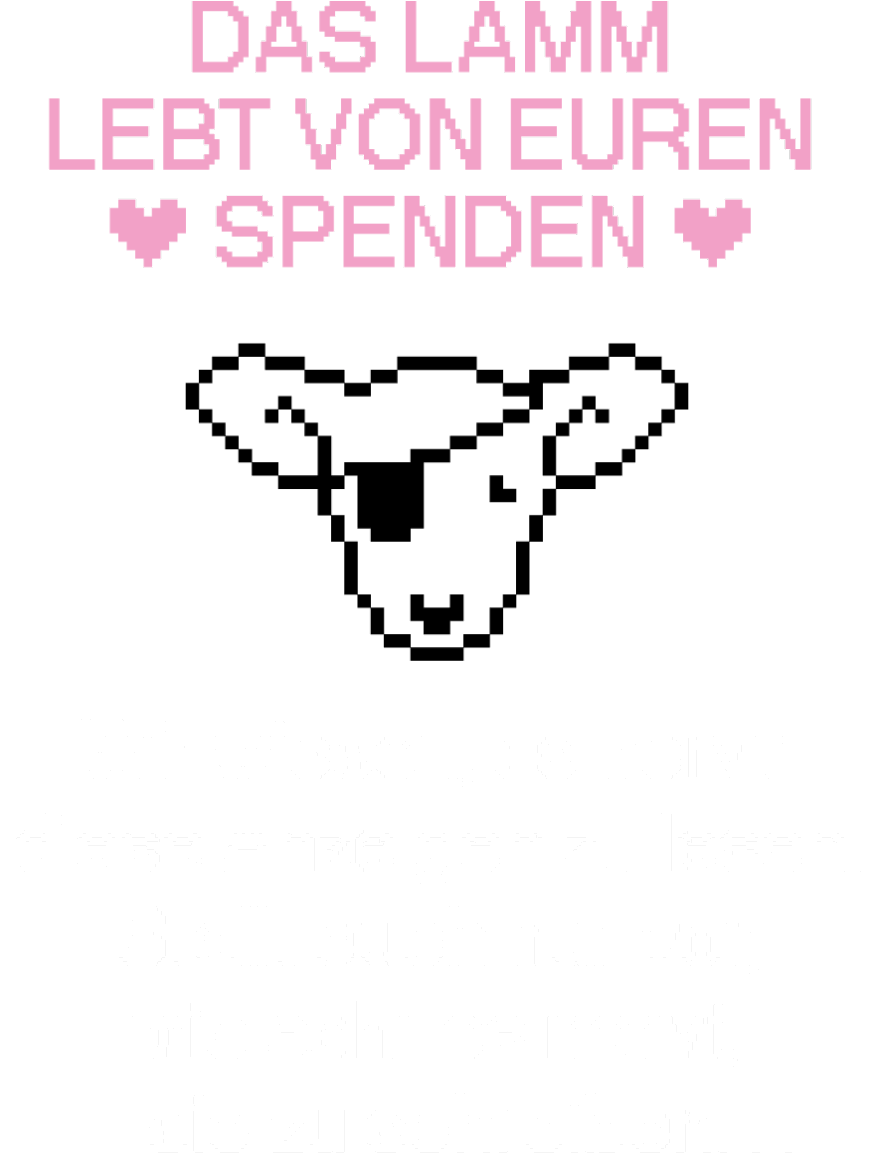Die junge Generation sei faul und würde lieber arbeitslos als unzufrieden mit ihrer Arbeit sein, monieren Gegner*innen einer allgemeingültigen Reduktion der Erwerbstätigkeit. Doch was ist es, das eine Arbeitszeitreduktion so attraktiv macht?
Für die Schweizer Stimmbevölkerung nichts, könnte man meinen: Vor rund zehn Jahren lehnten die Schweizer Stimmberechtigten die Ferieninitiative ab. Aus den bis dahin geltenden vier Wochen Mindesturlaub wären mit der gewerkschaftlichen Initiative sechs geworden. 66 Prozent stimmten dagegen.
Eine Stimmbevölkerung, die sich gegen mehr Ferien, Freizeit und Raum für Erholung ausspricht?
Was paradox klingt, ist in der Schweiz Normalität. Die Bewahrung des Wohlstands durch individuellen Fleiss und mehr Arbeit gilt als Schweizer Selbstverständlichkeit.
Nun aber bringt die Wissenschaft selbst diese Erzählung ins Wanken: Das Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern veröffentlichte kürzlich ein Paper zum Thema Arbeitszeitreduktion. Dieses zeigt, dass eine gesamtgesellschaftliche Reduktion der Erwerbsarbeit grosses Potential für positive Einflüsse auf Umwelt, Lebenszufriedenheit und eine funktionierende Wirtschaft haben könnte.
„Bis vor kurzem wäre eine Reduktion der Wochenarbeitszeit in der Schweiz eine Sache der Unmöglichkeit gewesen”, sagt Christoph Bader, Wissenschaftler am CDE, der an besagtem Paper beteiligt war. Auch die Pandemie habe vor Augen geführt, wie schnell die Politik zu reagieren fähig sei – zum Beispiel durch die Finanzierung der Kurzarbeit, meint Bader. Dies habe den Weg geebnet zur erneuten Auseinandersetzung mit der Arbeitszeitreduktion.
In den letzten zwei Jahren ging es plötzlich schnell: Erste Schweizer Firmen stellten auf eine Vier-Tage-Woche um, Gewerkschaften wie Syndicom und UNIA forderten eine 35-Stunden-Woche. Island ging mit einer Vier-Tage-Woche beispielhaft voran, verzeichnete einen überwältigenden Erfolg und ebnet so den Weg für Initiativen in anderen Ländern – auch in der Schweiz.
Im Dezember 2021 wagte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello einen politischen Vorstoss beim Schweizer Parlament, um eine Maximalarbeitszeit von 35 Wochenstunden für mittlere und tiefe Einkommen zu erzielen. Der Bundesrat schmetterte die Initiative mit dem Argument ab, dass ein solcher Beschluss „eine Abkehr von zentralen Elementen der Schweizer Arbeitsmarktpolitik” bedeuten würde.
Trotzdem geht die Diskussion auch in der Schweiz weiter. Im April griff zum Beispiel der „Strike For Future” das Thema auf. „Wir sind am Ende der menschlichen und planetaren Grenzen angelangt, die Produktion muss gedrosselt werden”, finden Hannah Borer und Mattia De Lucia, Aktivist*innen aus Zürich. Eine radikale Reduktion der hiesigen Arbeitszeit könne ein Mittel dafür sein.
Der positive Effekt aufs Klima
Die positiven Auswirkungen auf das Klima sind ein essentieller Grund, der für eine Reduktion der Erwerbsarbeitszeit spricht. Gemäss Studien zu OECD-Ländern würde sich unser CO2-Fussabdruck im Durchschnitt um ganze 14,6 Prozent reduzieren, wenn wir unsere Arbeitszeit um zehn Prozent verringern würden. Eine Verringerung um 25 Prozent entspräche sogar einem um 36,6 Prozent geringerem ökologischen Fussabdruck.
Diese Reduktion beinhaltet einerseits die gesparte Energie durch weniger Produktion, aber auch das Wegfallen von Pendelstrecken. „Natürlich ist das nur eine Modellrechnung”, kontextualisiert Bader die genannten Zahlen.
„Wir sind am Ende der menschlichen und planetaren Grenzen angelangt, die Produktion muss gedrosselt werden.”
– Hannah Borer und Mattia De Lucia, Aktivist*innen aus Zürich
Der Zusammenhang von geleisteten Arbeitsstunden und CO2-Emissionen ist ausserdem nicht für alle Länder gleich. „Für weniger stark entwickelte Volkswirtschaften ist ein steigendes Wachstum möglicherweise immer noch sinnvoll, während wir in der Schweiz mit unserem Konsum deutlich runter sollten”, erklärt der Wissenschaftler. Ausschlaggebend sei das Zusammenspiel des Arbeitszeit- und Einkommensniveaus und die Art und Weise, wie die neu gewonnene Zeit genutzt wird.
Studien zeigen, dass wir gerade in unserer Freizeit die meisten Emissionen verursachen, insofern wir das Geld dazu haben. Denn je mehr wir verdienen, desto grösser werden unser Klima-Fussabdruck und Ressourcenverbrauch.
Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Wer mehr Geld hat, lebt tendenziell auf grösserem Fuss, verreist öfter und kauft sich mehr Dinge, als Personen mit weniger Geld. Ein ökologischer Effekt auf der individuellen Ebene würde sich vor allem dann einstellen, so die Wissenschaftler*innen des CDE, wenn wir in der neu gewonnen Freizeit ressourcenleichte Tätigkeiten wählten: Uns also zum Beispiel um soziale Beziehungen kümmerten, weiterbildeten oder einem freiwilligen Engagement nachgingen.
Die skurrile Diskussion um Produktivität
Ein komplexer Aspekt im Zusammenhang mit einer verminderten Arbeitszeit ist die Produktivität, also wie viel Wertschöpfung im Verhältnis zum Zeitaufwand erfolgen kann. Zahlreiche Studien zeigen, dass verringerte Wochenarbeitsstunden zu einer erhöhten Produktivität der Arbeitnehmenden führt, da sie sich etwa besser von ihrer Arbeit erholen können.
Grosse Konzerne wie Kellogg’s oder Unilever haben dies früh erkannt und sich zunutze gemacht. Doch: „Eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit darf nicht als Mittel zur Steigerung von Produktivität und Profit von Unternehmen führen”, wenden die Aktivist*innen ein. Damit wäre der ökologische und somit auch der soziale Effekt einer Arbeitszeitreduktion dahin.
„Wir müssen also ein anderes Mass als die Arbeitsproduktivität finden, eine Art von Qualitätsmass. Es braucht ein anderes Ziel als das Wachstum der Wirtschaft als Selbstzweck.”
– Christoph Bader, Wissenschaftler am CDE
Während die Arbeitsproduktivität in der Schweiz zwischen 1991 und 2017 um 26 Prozent gestiegen ist, sind die Reallöhne lediglich um 14 Prozent in die Höhe, so der Bericht des CDE. Das durch höhere Arbeitsproduktivität entstehende Wachstum schlug sich also nicht in einer Entlastung oder einer finanziellen Besserstellung der Lohnabhängigen nieder. Im Gegenteil: „Die Ungleichheit ist in dieser Zeit gestiegen. Das ist durchgehend für fast alle OECD-Staaten”, sagt Wissenschaftler Bader.
In den 1990ern war auch die Digitalisierung auf Hochkurs, die viele Arbeitsabläufe beschleunigte und die Produktivität steigen liess. So lag 1950 die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der Schweiz bei bei 47,7 Stunden, 2020 noch bei 41,7 Stunden. Damit verfügt die Schweiz allerdings immer noch über eine der höchsten wöchentlichen Erwerbsarbeitszeit in Europa.
Gleichzeitig hat die durchschnittliche Wertschöpfung – also die Transformation vorhandener Güter in Güter mit höherem Geldwert – pro Arbeitsstunde in der Schweiz seit Mitte der 1990er um lediglich ein Prozent pro Jahr zugenommen. Während das Wirtschaftswachstum hochentwickelter Volkswirtschaften seit geraumer Zeit stagniert, scheinen sich neben den ökologischen auch die ökonomischen Grenzen sichtbarer zu zeigen.
Aus einer ökologischen Perspektive ist ein Wachstumsschwund grundsätzlich als positiv zu bewerten, schlussfolgern die Wissenschaftler*innen des CDE. Allerdings stelle er für unser aktuelles Wirtschaftssystem, das strukturell auf ein ständiges Wachstum ausgerichtet ist, ein Problem dar: Vermindertes Wachstum führe zum Beispiel dazu, dass unsere derzeitige Wirtschaft nicht mehr genügend neue Arbeitsplätze schafft, um die Arbeitsplätze, die durch den Anstieg der Arbeitsproduktivität wegfallen, zu kompensieren.
Christoph Bader: „Wir führen diese skurrile Diskussion über Produktivität. Aber in der Bildung oder der Gesundheit wird nichts produziert, das immer noch effizienter geleistet werden könnte, sondern man bietet eine möglichst gute Dienstleistung an. Wir müssen also ein anderes Mass als die Arbeitsproduktivität finden, eine Art von Qualitätsmass. Es braucht ein anderes Ziel als das Wachstum der Wirtschaft als Selbstzweck.” Die Wirtschaft stecke in der sogenannten Produktivitätsfalle, so Bader.
Die Verminderung der Arbeitslosigkeit
Befürworter*innen einer Arbeitszeitreduktion nennen gerne einen weiteren positiven Effekt: die Verminderung der Arbeitslosigkeit. Durch eine sogenannte „kurze Vollzeit” – 35 statt 42 Stunden pro Woche bei 100 Prozent zum Beispiel – würden Stellenprozente und somit Jobs frei.
Wie das insgesamt zu handhaben wäre? Etwa über eine Umverteilung der Arbeitskräfte, wie die Aktivist*innen Hannah Borer und Mattia De Lucia vom Strike For Future meinen: „Arbeitsstellen in unnötigen oder klimaschädlichen Branchen müssen abgebaut, Bereiche wie die Pflege oder ökologisch sinnvolle Bereiche dafür aufgestockt werden.”
Durch den sogenannten „Personalausgleich” könnte die Nachfrage nach Arbeitskräften zunehmen, sagt die Aktivistin. „Somit könnte das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgeber*innen verschoben werden.”
Es gibt auch Kritiker*innen der Theorie, dass eine Arbeitszeitreduktion zu weniger Arbeitslosigkeit führen würde. So auch der Ökonom Maurice Höfgen. Er ist der Meinung, dass ein Personalausgleich deshalb unrealistisch sei, da profitorientierte Betriebe überhaupt erst bei einer Zunahme der Produktivität eine Arbeitszeitreduktion in Betracht ziehen würden. Das heisst, erst wenn ein Unternehmen beispielsweise 20 Prozent produktiver sei, käme für sie in Frage, die Arbeitszeit um 20 Prozent zu reduzieren – allerdings würden so keine neuen Arbeitsstellen frei.
„Natürlich kommt es immer auf die Begleitmassnahmen und die Ausgestaltung einer Arbeitszeitreduktion an”, kontert Bader vom CDE. Es gäbe auch Beispiele, in denen die Unternehmen nicht alleine mit den Konsequenzen einer Arbeitszeitreduktion umgehen müssten. „In Österreich beispielsweise gibt es ein Programm für einzelne Branchen, in welchem der Staat den vollen Lohn oder Teile davon übernimmt, wenn Firmen eine arbeitslose Person einstellen”, erläutert der Wissenschaftler. So hätten Unternehmen den Anreiz, einen Personalausgleich zu vollziehen, und die verbleibende Arbeit würde auf mehr Leute aufgeteilt.
Die Förderung der Gleichstellung
Die Schweiz ist nicht nur eine der Spitzenreiter*innen bei der wöchentlichen Normalarbeitszeit, auch der Anteil von 35 Prozent Teilzeitarbeitenden ist einer der höchsten in Europa. Die Geschlechterungleichheit, die dabei zum Vorschein kommt, wurde vom britischen Magazin The Economist als eine der grössten Europas eingestuft.
Mit der unterschiedlichen Verteilung der Teilzeitarbeit geht die Ungleichverteilung der unbezahlten Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern einher. 2016 übertraf in der Schweiz die sogenannte Care-Arbeit mit 9,2 Milliarden Stunden die geleistete Erwerbsarbeit von 7,9 Milliarden Stunden. Diese Diskrepanz schlägt sich auch in einer niedrigeren sozialen Absicherung nieder: Wer Teilzeit beschäftigt ist, unterliegt einem grösseren Armutsrisiko.
„Bei einer radikalen Arbeitszeitreduktion müssten wir vermutlich auch unsere Sozialsysteme anders finanzieren.”
– Christopf Bader, Wissenschaftler am CDE
Eine Senkung der Arbeitszeit hin zu einem Modell mit weniger Wochenstunden würde also einerseits die Erwerbsarbeit von Frauen aufwerten und andererseits zumindest theoretisch mehr Lebenszeit von Männern für Fürsorge- und Hausarbeit zur Verfügung stellen. Das Beispiel Island bestätigt die Theorie, dass Care-Arbeit bei einer Verkürzung der Arbeitszeit deutlich gerechter verteilt wird. So haben Männer zum Beispiel mehr Initiative bei der Hausarbeit gezeigt, wenn sie weniger Zeit in ihre Lohnarbeit investieren mussten.
Die Schere bei der Altersarmut könnte sich durch ausgeglicheneres Einzahlen in die Rentenkasse verringern und auch gegen den Gender-Pay-Gap könnte eine Arbeitszeitreduktion wirkungsvoll sein. „Im Moment springen viele Arbeitskräfte aus dem Ausland für uns ein, wenn zum Beispiel beide Elternteile arbeiten”, erinnert die feministische Aktivistin Hannah Borer an die global Care-Chain. Demnach könnte eine Reduktion der Arbeitszeit ein nützliches Werkzeug sowohl gegen geschlechterspezifische als auch gegen die Benachteiligung von ausländischen Arbeitskräften sein.
Die Verbesserung der Gesundheit
Arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme sind häufig und divers: Von Rückenschmerzen über Lärm bis hin zu sexualisierter Gewalt gibt es viele Dinge, die Arbeitnehmende belastet. Im Durchschnitt ist die Gesundheit von einem unter vier Männern und einer von sechs Frauen in der Schweiz durch ihre Arbeit beeinträchtigt. Hochgerechnet sind 1.1 Millionen der lohnabhängigen Erwerbstätigen betroffen.
Laut dem Job-Stress-Index sind auch rund ein Drittel der fünf Millionen Erwerbstätigen in der Schweiz emotional erschöpft. Diese psychische Belastung ist ein wesentlicher Kostenverursacher im Gesundheitswesen. Der durch Stress entstandene Schaden aus Produktivitätsverlust wird für die Schweizer Betriebe auf 6.5 Milliarden Franken oder ein Prozent der Wirtschaftsleistung geschätzt. Eine Reduktion der Erwerbsarbeit kann dafür ein gutes Mittel gegen psychische Überlastung sein.
Die Möglichkeiten der Finanzierung
Somit kommen wir auch schon direkt zu der Frage der Finanzierung. Die Wissenschaftler*innen des CDE haben verschiedene Modelle dazu ausgearbeitet. Aufgrund der hohen arbeitsbezogenen Gesundheitskosten könnte es nämlich sein, dass durch eine Arbeitszeitverkürzung keine zusätzlichen Kosten anfallen.
Es ist die attraktivste Möglichkeit zur Finanzierung: Niemand muss die Kosten tragen, da diese entweder gar nicht anfallen oder durch weniger Gesundheitskosten kompensiert werden. „Wenn arbeitsbezogene Krankheiten wie Stress, Burnout und Boreout zurückgehen und so die Gesundheitsausgaben sinken, wären auch weniger Arbeitslosen- und Sozialhilfeausgaben nötig”, schlussfolgert Bader.
Diese Möglichkeit belastet die Arbeitnehmenden: Ihr Lohn geht ganz einfach proportional zu der Arbeitszeitreduktion zurück. Es findet also kein Lohnausgleich statt. Dieses Modell ist insofern problematisch, weil es die Kosten auf einzelne Person abwälzt, keine gesamtgesellschaftliche Lösung bietet und sozial daher nicht verträglich ist.
Hier wird die sogenannte „kurze Vollzeit” von den Arbeitgebenden getragen, indem die Löhne gleich bleiben, auch „Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich” genannt. So steigen die Produktionskosten während die Gewinne der Unternehmen sinken – für Firmen also keine sehr attraktive Strategie.
Bei dieser Variante kommt ein Zuwachs der Produktivität den Arbeiter*innen anstatt den Kapitalinhaber*innen zugute. Es könnte jedoch sein, dass Arbeitgeber*innen als Ausgleich die Preise ihrer Produkte erhöhen, wodurch die Kosten der kurzen Vollzeit zumindest teilweise wieder auf die Arbeitnehmenden (in dem Fall als Konsument*innen) zurückfallen würden.
Die dritte Möglichkeit, die die Wissenschaftler*innen des CDE sehen, ist die Quersubvention durch alternative Einnahmequellen – also durch den Staat, beziehungsweise unsere Steuern. Dies wäre beispielsweise möglich, indem es eine Verlagerung der Besteuerung, weg von der Arbeit, dafür hin zu einer vermehrten Besteuerung von Kapital und Umweltauswirkungen stattfinden würde.
Denn heute werden unsere Sozialsysteme grösstenteils durch die Besteuerung von Arbeit finanziert: Rund die Hälfte des Steueraufkommens der öffentlichen Hand basiert auf der Besteuerung von Arbeit – entweder direkt durch die Einkommenssteuern oder indirekt durch Lohnbeiträge an die Sozialversicherungen.
Christoph Bader meint, dass eine absolute Reduktion der Erwerbsarbeitszeit bei der jetzigen Ausgestaltung der Finanzierung der Sozialsysteme negative Auswirkungen auf deren Sicherheit hätte. Eine soziale-ökologische Transformation der Erwerbsarbeit müsse daher auch zu einer zumindest teilweisen Entkopplung der Erwerbsarbeit von der Existenzsicherung, im Sinne der Abhängigkeit von den Sozialsystemen, führen.
Die Wissenschaftler*innen des CDE selbst propagieren eine Mittelweg-Variante: Die Erwerbsarbeitszeitreduktion mit abgestuftem Lohnausgleich. Gemäss ihren Analysen nähme ab dem Medianeinkommen, das 2020 in der Schweiz bei 6’665 Franken lag, die Zufriedenheit mit zusätzlichem Einkommen nicht weiter zu. Gleichzeitig steige ab dem Medianeinkommen der ökologische Fussabdruck markant an.
Arbeitnehmende, die jetzt Vollzeit arbeiten und dabei weniger als den Medianlohn verdienen, könnten ihre Arbeitszeit reduzieren und dabei gleich viel verdienen wie zuvor. Sie hätten so zwar nicht mehr Geld, dafür aber mehr Zeit zur Verfügung, die sie für zeitintensive, aber ressourcenleichte Tätigkeiten einsetzen könnten.
Arbeitnehmende, deren Einkommen leicht über dem Medianlohn läge, erhielten einen abgestuften Lohnausgleich, während diejenigen mit den höchsten Einkommen keinen Lohnausgleich erhielten. Vielverdiener*innen hätten somit mehr Zeit, gleichzeitig jedoch weniger Geld als zuvor zur Verfügung, was die ökologischen Kosten ihres Lebensstils beschränken könnte.
Ein mögliches Instrument zur Umsetzung und Finanzierung eines abgestuften Lohnausgleichs wäre eine die sogenannte „negative Einkommenssteuer”, bei welcher Haushalte mit tiefem Einkommen eine Ausgleichszahlung erhielten. Mit steigendem Einkommen nehmen die Transferleistungen bis zu einem zu bestimmenden Schwellenwert ab. Wer darüber liegt, muss Einkommenssteuern zahlen. Dies funktioniere allerdings nur, wenn genügend bezahlte und existenzsichernde Arbeitsstellen verfügbar sind, so das CDE.
Was jetzt?
„Wir müssen auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig ansetzen”, ist sich Bader sicher. Dann hätten auch politische Vorstösse viel mehr Kraft. „Und somit wird auch die Chance grösser, dass wir gesamtgesellschaftlich etwas erreichen.” Die Ausarbeitung der Arbeitszeitreduktion müsste branchenspezifisch angepasst werden, so der Wissenschaftler. Ausserdem sei eine Verminderung der Erwerbsarbeitszeit nur ein Puzzleteil von vielen auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Transformation.
Hannah Borer und Mattia De Lucia sehen in einer radikalen Arbeitszeitreduktion ein Werkzeug, das einen ersten Ansatz zur Verbesserung vieler Probleme vereint. „Was wir jetzt tun müssen, ist den Diskurs weiter zu fördern, uns zum Beispiel mit unseren Mitarbeiter*innen zu organisieren und uns zu fragen: Was würde eine Arbeitszeitreduktion eigentlich für uns bedeuten?”
Die Diskussion um eine reduzierte Erwerbsarbeitszeit sei nicht neu, so die Aktivist*innen. Dass wir heute nicht noch viel mehr arbeiten, hätten wir verschiedenen Arbeitskämpfen in der Vergangenheit zu verdanken. Es gälte, diese Bewegung weiter zu führen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 45 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2600 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1575 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 765 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?