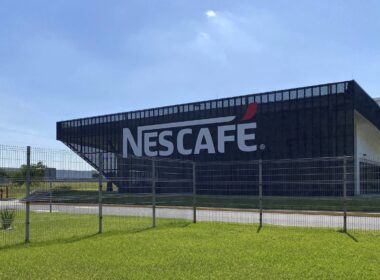Jeden Tag sieht der 38-jährige Jorge Elías Cubero Toro von seiner Wohnung aus in der Ferne schwarze Rauchsäulen emporsteigen: „Was das bedeutet, kann ich nur vermuten.“ Er lebt im südlichen Zentrum Guayaquils, der am stärksten von Corona betroffenen Stadt Ecuadors mit einer der höchsten Prävalenzraten der Welt. Cubero Toro kennt die vielen Videos, die momentan im Internet kursieren: Sie zeigen Menschen, die aus Verzweiflung ihre verstorbenen Angehörigen verbrennen, weil sie nicht mehr bestattet werden können.
Auch, weil es in Ecuador kaum Krematorien gibt. Die meisten Einwohner*innen können sich die Einäscherung ihrer Angehörigen nicht leisten, und die Friedhöfe sind überlastet. Inzwischen fällt für die Bestattung sogar ein Sondertarif an.
Die Leute auf den Strassen Guayaquils sind der Meinung, der Staat habe versagt, sagt Cubero Toro. „Er ignoriert die Bitten der Menschen aus den Vorstädten und den am stärksten betroffenen Gebieten der Stadt.“ Denn dass das System zur Abholung und Pflege von Toten in sich zusammengebrochen ist, ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch die Kapazitäten des Gesundheitssystems der Provinz sind längst ausgeschöpft. „Die, die das Glück haben, behandelt zu werden, sterben meistens im Gesundheitszentrum“, sagt Cubero Toro. Wie es vielen anderen in seinem Quartier gehe, habe er selbst miterlebt, erzählt er: „Vor einer Klinik nur wenige Blocks von hier schrie kürzlich eine Frau am Eingang des Notfalls nach Hilfe, ihr Mann war zusammengebrochen – aber der Eintritt in die Klinik blieb ihnen verwehrt.“
Zahlen werden vertuscht
Am Freitag sagte der Bürgermeister der Provinz Guayas Carlos Luis Morales gegenüber CNN, dass ihm die Veröffentlichung der aktuellen Zahlen von der Regierung um Lenín Moreno verboten worden sei. Kürzlich wurde eine Task-Force ins Leben gerufen, um mehr Verstorbene bergen zu können. Ihr Sprecher Jorge Wated spricht von 100 Toten, die seine Task-Force jeden Tag aus den Häusern Guayaquils abhole.
Die Allgemeinärztin Sharon Velasco arbeitet fünf Stunden entfernt von Guayaquil in der Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas in der Qualitätssicherung eines öffentlichen Spitals. Auch hier werden Patient*innen aus Guayaquil betreut, die aufgrund der prekären Lage des dortigen Gesundheitssystems mit eigenen Mitteln nach Santo Domingo gereist sind. „Dass hier das gleiche wie in Guayaquil eintrifft, ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir keine Unterstützung von der Regierung bekommen“, meint Velasco.
Dabei schien es zunächst so, als sei Ecuador eines der südamerikanischen Länder, die im Wettlauf gegen das Virus rechtzeitig Massnahmen ergriffen hatten. Die Regierung schloss die Grenzen schon Mitte März und verhängte verschiedene Dekrete, die das öffentliche Leben einschränkten. Allerdings arbeitet die Hälfte der Einwohner*innen Ecuadors im informellen Sektor, und die Ausgangssperren wurden vermutlich nicht wirklich eingehalten. Auch Cubero Toro berichtet von bevölkerten Strassen trotz der Ausgangssperre von 14:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens.
Der Zenit ist noch nicht erreicht
Sharon Velasco rechnet in den nächsten Wochen mit einem markanten Anstieg der Infizierten in Santo Domingo de los Tsáchilas und in den anderen Regionen Ecuadors. „Und wir sind nicht darauf vorbereitet.“
Es fehle zum einen an medizinischem Personal – obwohl Ecuador eigentlich über genügend ausgebildete Fachkräfte verfüge. „Das Problem ist der Abzug von Mitarbeitenden in den Spitälern von Guayaquil“, sagt Velasco. Laut ihr wurden rund 40 Prozent des medizinischen Personals aus den Spitälern abgezogen oder sie haben selbst gekündigt, weil für sie ein erhöhtes Risiko besteht, an Covid-19 zu erkranken.
Dies werde von der Regierung aus verschiedenen Gründen aber nicht kommuniziert. Einerseits fehle es an Berichten, die die Arbeitsabläufe und die Situation in den Spitälern dokumentieren, und andererseits arbeitet das administrative Personal, das diese Protokolle erstellen sollte, jetzt von Zuhause aus. „Berichte zur Situation im Spital zu verfassen, stelle ich mir so als sehr schwierig vor“, meint Velasco. „Wir sind jetzt aber an einem Punkt angelangt, wo die Behörden nicht mehr vertuschen können, was hier geschieht.“
Zum anderen – und vor allem – fehle es an medizinischem Zubehör, sagt die Ärztin. An Schutzmaterial, Medikamenten – und Beatmungsgeräten. Laut Velasco liege die Mortalitätsrate in den Intensivstationen Guayaquils bei fast 100 Prozent. „Wir sind technisch in ganz Ecuador im öffentlichen Bereich viel zu wenig gut ausgerüstet, um die Patienten richtig versorgen zu können“, sagt sie.

Zu wenig Hilfe – zu spät
Von Seiten der Regierung wurde am Wochenende in einem Communiqué die Bereitstellung einer Spende der südamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) von Operationskitteln, Handschuhen, Masken und weiterem Zubehör für das medizinische Personal angekündigt. Velazquez zufolge kommt diese Hilfe zu spät, und sie ist ungenügend. „Nach wie vor gibt es kein nationales Gesetz, dass die Handhabung der Grundversorgung regelt“, sagt sie. So gibt es keine Preisüberwacher bei den Hygieneprodukten und auch keine Verfügbarkeitsregelung.
Auch Cubero Toro ist der Meinung, dass sich die Einwohner Guayaquils schlecht oder gar nicht vor dem Virus schützen können. Masken und Desinfektionsmittel seien in den Geschäften nicht mehr erhältlich. „Die Strassenverkäufer verkaufen gebrauchte Mundstücke für Schutzmasken, als wären sie neu, und die Desinfektionsmittel entsprechen nicht dem nötigen Standard“, so Cubero Toro.
Seit diesem Wochenende scheint die Regierung in Ecuador endlich angemessen reagieren zu wollen. Am Samstag entschuldigte sich Otto Sonnenholzner, der Vizepräsident der Republik, im nationalen Fernsehen für die Fehler, die im Umgang mit der Pandemie vonseiten der Regierung begangen wurden. Weiter versprach er, insgesamt 1’500 neue Krankenhausbetten in den öffentlichen Spitälern Guayas’ zur Verfügung stellen zu wollen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 11 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 832 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 385 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 187 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?