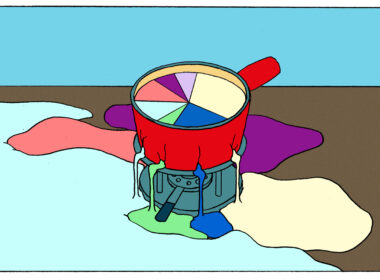Sein bester Freund aus Kindergartenzeiten sei soeben an COVID-19 verstorben. Der Mann erzählt, wie die beiden Freunde einander durch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs geholfen hatten, wie sie den Kontakt später über zwei Kontinente hinweg aufrechterhalten konnten, wie sie die alljährlichen Skiferien zusammen verbrachten und wie schmerzhaft sich dieser Verlust jetzt anfühlt.
Er nimmt sich viel Zeit, um alles zu erzählen, und Anita Winter hört zu. Es ist nur einer von vielen Anrufen von Holocaustüberlebenden, die sie und ihr Team von der Stiftung Gamaraal in diesen Tagen entgegennehmen. „Wir nennen das Besuche per Telefon“, erklärt Winter am Telefon. „Die meisten möchten einfach mit jemandem reden – über ihren Alltag, über ihre Ängste und über ihre Sorgen.“ Besuchen kann die hochbetagten Personen niemand mehr.
Die Stiftung Gamaraal unterstützt seit 2014 Holocaustüberlebende in der Schweiz. Sie organisiert Schulbesuche, führt Ausstellungen durch (teils auch umstrittene) und leistet finanzielle Hilfe an Überlebende. Denn: Laut Schätzungen der Jewish Claims Conference, welche Forderung zur Wiedergutmachung für Holocaustüberlebende geltend macht, lebt etwa die Hälfte aller Holocaustüberlebenden in Armut. Jetzt, während der Corona-Pandemie, führt die Gaamaraal-Stiftung zusätzlich eine Hotline und organisiert mit Dutzenden Freiwilligen in der ganzen Schweiz die Einkäufe für die Überlebenden. „Wir erleben gerade eine unglaubliche Generationensolidarität.“
Viele Überlebende hätten schon weit schlimmere Zeiten überlebt, in Armut, oftmals ohne warme Kleider oder Essen. „Der Durchhaltewille dieser Generation ist einfach bewundernswert“, sagt Anita Winter. Als Tochter einer Deutschen Holocaustüberlebenden und eines Zeitzeugen der Berliner Pogrome 1938 weiss sie, wovon sie spricht. Ihre Mutter ist Anfang Jahr verstorben, ihr Vater 2019.
Laut offizieller Statistik leben rund 450 Holocaustüberlebende in der Schweiz. Es sind vor allem Deutsche, Ungar*innen, Slowak*innen, Tschech*innen. Von den 391 Schweizer*innen, die in einem Konzentrationslager interniert waren, hatten mehr als die Hälfte die Folter nicht überlebt. Doch die Dunkelziffer ist laut Winter gross. Überlebende zu erreichen, sei nicht einfach: Viele wollen sich nicht als Holocaustüberlebende sichtbar machen. „Das hat für sie schon einmal das Todesurteil bedeutet, weil sie dann auf einer Liste gelandet sind.“
Heute gehören die Holocaust-Überlebenden wieder zur Risikogruppe. COVID-19 ist nicht nur bedrohlich für die Einzelpersonen, die sich jetzt in ihren Wohnungen verschanzen müssen. Auch für die Erinnerungskultur, die erinnerungspolitische Aufarbeitung der Shoa, ist das Virus einschneidend.
So waren für dieses Jahr, 75 Jahre nach Kriegsende, überall in Europa Gedenkfeiern, Vorträge und Bildungsveranstaltungen geplant. „Wir mussten wegen der Corona-Pandemie viele Schulbesuche von Überlebenden und Veranstaltungen absagen, etwa unsere Ausstellung in Schaffhausen“, sagt Anita Winter. Den Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen mit Überlebenden musste Winter auch verschieben, vorerst auf den 14. Juni. „Den Betroffenen setzt der Entscheid sehr zu, sie wollten sich ein letztes Mal treffen.“

Auch bei den Gedenkstätten des Konzentrationslagers Buchenwald und Mittelbau-Donau in Weimar fallen Gedenkveranstaltungen aus. Der Stiftungsdirektor sagt dazu im Interview: „Uns war klar, dass dieser Jahrestag den Abschied der Überlebenden markiert.“ Es wären nochmals 42 Überlebende gekommen, die meisten über 90 Jahre alt. Jetzt fallen alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus. „Das schmerzt, insbesondere in einer Zeit, in der rechtes Gedankengut erneut an Popularität gewinnt.“ Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigen die verschiedenen antisemitischen Verschwörungstheorien zum Coronavirus, die gerade durch die sozialen Medien geistern.
Erinnerung an die Typhus-Epidemie 1943
Nina Weil, 88 Jahre alt, konnte Anfang Jahr das KZ Auschwitz zum Jahrestag der Befreiung gerade noch besuchen. Zusammen mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und weiteren Überlebenden beging sie im Januar das Konzentrationslager. Wohl zum letzten Mal.
Bilder von diesem Besuch, die hunderte hochbetagte Menschen mit ineinander verschränkten Armen zeigen, scheinen wie aus der Zeit gefallen. Nina Weil bleibt jetzt zu Hause – „ausser, wenn ich niemanden auf der Strasse sehe, dann laufen wir manchmal kurz ums Haus“, erzählt die gebürtige Tschechin am Telefon. Ansonsten bleiben sie und ihr Ehemann in der Wohnung, bei schönem Wetter könne man sie aber auf ihrem kleinen Balkon sitzen sehen.
Von ihrer Lebensgeschichte, ihrer Kindheit in Prag, der Deportation ins Ghetto Theresienstadt, von der Aussortierung durch Josef Mengele in Auschwitz und den Todesmärschen: Davon kann sie im Moment nur per Telefon erzählen. An öffentliche Vorträge und an Besuche in Primarschulen und an Fachhochschulen ist wegen der Ansteckungsgefahr nicht zu denken.
Dabei hat Weil viel zu erzählen – auch zur Corona-Pandemie. „Die Situation erinnert mich an die Fleckentyphus-Epidemie im Ghetto von Theresienstadt 1943“, sagt Weil. Damals lebte sie in einem Kinderheim; ihr Mutter war in einer der unzähligen Kasernen einquartiert. „Wir schliefen auf dreistöckigen Holzpritschen, immer fünf Leute auf einer Ebene.“ Überall habe es nur so von Wanzen gewimmelt, welche die Kinder im Schlaf wund bissen. „So breitete sich der Typhus rasant aus.“ Typhus führt zu krampfhaften Bauchschmerzen, Fieber und Husten, und ist heute, dank Impfungen, in der Schweiz fast vollständig ausgerottet.

Die Bewohner*innen des Ghettos Theresienstadt hatten aber keinen Zugang zu Impfungen, und die achtjährige Nina Weil musste ins einzige Spital im Ghetto gebracht werden. Im September 1942 waren dort 58’000 Menschen interniert, auf einer Fläche, die vor der Besatzung gerade einmal 7’000 Menschen bewohnt hatten. Wie viele Menschen der Typhus-Epidemie in Theresienstadt erlagen, ist schwer abzuschätzen, aber eine Zahl ist bekannt: In den letzten Kriegstagen und ersten Friedenswochen starben über 1’500 ehemalige Internierte aus Theresienstadt an Typhus und anderen Infektionskrankheiten.
Die Situation sei dramatisch gewesen, erinnert sich Weil. „Meine Mutter meldete sich freiwillig als Krankenschwester und spendete mir Blut.“ Innerhalb von vier Wochen konnte sie das Spital verlassen. Kurze Zeit später wurde sie mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Auschwitz abtransportiert.
„Es braucht noch viel Erinnerungsarbeit”
Heute hat sie nur noch mit wenigen anderen Holocaustüberlebenden Kontakt, etwa mit ihrem Cousin in Manchester. „Wir schreiben uns zweimal im Jahr. Er kann kein Deutsch und ich kein Englisch, deswegen müssen wir unsere Briefe jeweils übersetzten lassen”. Ansonsten aber seien viele Überlebende bereits gestorben. „Wissen sie, mit 88 bin ich eine der jüngsten Überlebenden. Nur wenige Kinder haben Auschwitz lebend verlassen”.
Nina Weil ist überzeugt, dass es noch viel Arbeit braucht, damit auch bei den kommenden Generationen das Bewusstsein für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs fortbesteht. „Für viele junge Menschen ist Auschwitz zeitlich etwa so weit entfernt, wie für mich die Eroberungskriege von Napoleon“, sagt Weil. Das Virus verdränge jetzt die Erinnerung an Auschwitz, den Holocaust. „Niemand möchte die alten Geschichte hören, wenn jeden Tag so viel Neues passiert.“
Ob sie nach der Corona-Pandemie wieder an Schulen ihre Lebensgeschichte erzählen wird? „Wir werden sehen, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Jahr mit Corona zu kämpfen haben“, meint sie nachdenklich. Gesundheit sei jetzt das Allerwichtigste für sie und ihren 96-jährigen Ehemann. „Alles Weitere schauen wir dann, wenn das Virus vorbei ist.“
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?