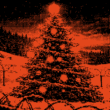Triggerwarnung: In diesem Text geht es um sexualisierte Gewalt. Er enthält einzelne explizite Beschreibungen.
Anja* will raus. Sie befindet sich in einer Wohnung in Basel, draussen wacht die Stadt gerade auf. Es ist sechs Uhr morgens. Anja nimmt ihr Handy, läuft zur Tür und rennt hinaus, ohne Hose, barfuss die Treppe hinunter, dann auf die Strasse.
Der Mann, mit dem Anja die letzte Nacht verbrachte, rennt ihr einige Meter hinterher. Bei einem grossen Platz erst hält sie an und setzt sich zu einer Person an die Bushaltestelle. Ihre Stimme ist schrill. „Es tut mir so leid. Ich bin gerade vergewaltigt worden.”
Eineinhalb Jahre später sitzt Anja in einem Park im Kleinbasel und knetet ihre Hände. Es ist Ende Januar und in einer Woche wird sie vor Gericht gegen den Mann aussagen müssen, der sie in dieser Nacht im Sommer 2019 vergewaltigt hat. Sie hofft, danach endlich mit dem Erlebnis abschliessen zu können. „Es ist für mich ein Schlussstrich”, sagt sie. Seit eineinhalb Jahren sei sie in dieser Vergewaltigung gefangen.
Was Anja in der Zeit seit der Tat durchgemacht hat, bringt sie an diesem kalten Tag im Januar 2021 zum Schluss: „Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, ich würde ihn nicht mehr anzeigen.”
Damit ist Anja nicht allein. 22 Prozent aller Frauen über 16 Jahren haben laut einer Studie des gfs Bern schon einmal ungewollte sexuelle Handlungen erlebt. Und trotzdem: Nur eine von zehn geht nach so einem Erlebnis zur Polizei, nur acht Prozent erstatten Anzeige. Rund die Hälfte aller Betroffenen spricht mit niemandem über das Erlebte, auch nicht mit Freund*innen oder Familie.
Wer Anjas Geschichte kennt, stellt fest: Etwas läuft gewaltig schief in der Ermittlung von Sexualdelikten. Bei den Behörden, in der Politik und in der Justiz. Warum?
Vor der Flucht
An einem Abend sitzt Anja bei dem Mann in der Wohnung. Sie haben sich vor einigen Wochen im Internet kennengelernt, hatten schon mehrmals einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. An diesem Abend bietet er ihr Benzodiazepin an, das gegen Angstzustände eingesetzt wird. „Was Mildes, zum Chillen”, sagt er ihr.
Anja verbringt die Nacht bei ihm. Im Laufe des frühen Morgens vergewaltigt er sie anal. Zu Beginn wehrt sich Anja noch, sie schreit und weint, fleht ihn an, von ihr abzulassen. Dann wird sie apathisch.
Die Tatsache, dass Anja sich in diesem Moment gewehrt hat, wird eineinhalb Jahre später, am Strafgericht Basel, von elementarer Bedeutung sein. Denn nur, wenn sich ein Opfer von Vergewaltigung gegen den Täter zur Wehr setzt, ist im Gesetz von „Sexueller Nötigung” oder „Vergewaltigung” die Rede.
Viele Betroffene von sexualisierter Gewalt schaffen es nicht, sich gegen die Täter zur Wehr zu setzen. Oft setzt eine sogenannte Opferstarre ein. Das heisst, dass der Körper der betroffenen Person sich versteift, sie sich nicht mehr bewegen und wehren kann.
Im schweizerischen Sexualstrafrecht wird dem bisher nicht Rechnung getragen. Es muss dem Täter nachgewiesen werden können, dass er sich wissentlich über die Grenzen der anderen Person hinweggesetzt hat, dass diese ihm klar gemacht hat, dass sie nicht will, was passiert. Das soll mit einer Revision teilweise verbessert werden.
Der Mann lässt auch nach mehrmaligem Flehen nicht von Anja ab. Als er fertig ist, ergreift sie die Flucht.
Im Unispital
Am Tag nach der Tat begibt sich Anja in die Frauenklinik des Unispitals. Am Empfang sagt sie: Ich bin anal vergewaltigt worden und will untersucht werden. Die nötigen Schritte werden eingeleitet, an viele Details kann Anja sich heute noch erinnern. Etwa, dass die diensthabende Ärztin gefragt habe, ob ihr nicht klar sei, dass die Tat 28 Stunden her sei, man im Falle einer Vergewaltigung jedoch in den ersten 24 Stunden vorbeikommen müsse.
In den Akten hingegen fehlt ein Bericht dieser Untersuchung. Als das Anja Monate später auffällt, stellt sie die Ärztin zur Rede. Anja habe sich damals gegen eine Untersuchung gewehrt, antwortet die Ärztin, worauf sie diese unterlassen habe. „Das ist seltsam”, sagt Anja heute, „ich war doch da, weil ich untersucht werden wollte.”
Zur Betreuung von Opfern sexualisierter Gewalt habe das Universitätsspital Basel ein Konzept, heisst es auf Anfrage bei der Kommunikationsabteilung. Unter den momentanen Umständen habe jedoch keine*r der Expert*innen Kapazitäten, dies zu erläutern. Das Konzept sei auch nicht einsehbar.
Das Krankenhaus ist in vielen Fällen von sexualisierter Gewalt der Ort, an dem ein Strafverfolgungsprozess ins Rollen kommt: Mitarbeitende ziehen bei der Untersuchung einer Betroffenen die Polizei bei, weil es sich bei Vergewaltigung und Nötigung um Offizialdelikte handelt. Die Polizei muss in solchen Fällen die Ermittlungen von Amtes wegen aufnehmen. Oft wollen die Betroffenen das nicht. Das hat laut der gfs Studie vielfältige Gründe: Einige denken, ihnen werde nicht geglaubt, andere sorgen sich um die Konsequenzen einer Anzeige. Die meisten Fälle sexualisierter Gewalt passieren im Freundes- und Bekanntenkreis.
Es ginge auch anders. Das sogenannte „Berner Modell” sieht vor, dass sich Betroffene von Fachpersonen untersuchen lassen und erst danach entscheiden können, ob sie Anzeige erstatten wollen. Die Spurensicherung wird von Rechtsmedizinerinnen geleistet, die Spuren danach sicher aufbewahrt. Bis zu einem Jahr nach der Tat kann die Betroffene dann noch Anzeige erstatten. Die Istanbulkonvention verpflichtet alle Kantone, das ebenfalls so zu regeln.
In Anjas Fall meldet das Krankenhaus nichts bei der Polizei – es gibt ja gemäss den Akten auch gar keine Untersuchung. Stattdessen schickt man Anja zum Ambulatorium der Universitären Psychiatrischen Klinik (UPK). Dort bekommt sie sechs Tabletten Beruhigungsmittel verschrieben. Zu Hause nimmt sie alle Tabletten in kurzem Abstand nacheinander ein. „Ich dachte in dem Moment nicht nach. Ich wusste einfach: Jetzt muss ich mich unbedingt beruhigen.”
An die zehn Tage, die danach folgten, hat Anja keine Erinnerung mehr. Sie habe wohl funktioniert, es gibt Fotos von ihr beim Haarefärben mit der Tochter, aber in ihrer Erinnerung ist da nur ein schwarzes Loch. Auch zum Täter ist sie offenbar in dieser Zeit zurückgekehrt.
Bei der Polizei
Zehn Tage nachdem sie die Tabletten eingenommen hatte, wacht Anja auf und ist bei klarem Verstand. Sie telefoniert herum, fragt bei Freundinnen nach einer geeigneten polizeilichen Person, die ihr jetzt eine Unterstützung sein kann. Bei der Wache warten zwei Mitarbeiter*innen der Sozialen Dienste und ein Polizist auf sie. Man nimmt sich Zeit für Anja, sie fühlt sich aufgehoben.
Nach stundenlangem Notieren teilt man ihr mit, es werde jetzt Anzeige erstattet, ob sie das wolle oder nicht. Anja fühlt sich hintergangen. Sie ist hergekommen, um Unterstützung zu bekommen. Anzeige hat sie ausdrücklich nicht erstatten wollen, aus Angst vor den Konsequenzen.
Weil Anja anal vergewaltigt wurde, wird die Straftat nicht als Vergewaltigung, sondern als sexuelle Nötigung verzeichnet. Im Schweizer Sexualstrafrecht ist eine Vergewaltigung immer noch dadurch gekennzeichnet, dass ein Penis in eine Vagina eindringt.
Für Fachpersonen ist das reine Formsache. Für Anja ist es eine tiefgreifende Unterscheidung. „Es klingt, als hätte ich keine tatsächliche Vergewaltigung erfahren.”
Agota Lavoyer kennt das Problem. „Gerade bei sexualisierter Gewalt wäre es förderlich, wenn juristische Begriffe jenen Bezeichnungen, die wir als Gesellschaft brauchen, entsprechen würden”, sagt sie im Gespräch. Lavoyer ist stellvertretende Leiterin und Beraterin bei Lantana, der Fachstelle Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt in Bern. Seit Jahren setzt sie sich für eine Sensibilisierung ein.
Die irreführende juristische Sprache führe häufig zu Missverständnissen, genauso wie fehlendes Einfühlungsvermögen seitens der Behörden. Sexuelle Nötigung ist ein Offizialdelikt, die Behörden sind also dazu verpflichtet, die Ermittlungen aufzunehmen.
„Hätte man Anja vor Ort aber besser aufgeklärt, würde sie sich nicht so hintergangen fühlen”, sagt Lavoyer. Um das zu bewerkstelligen, brauche es eine stärkere Schulung derjenigen Fachpersonen, die mit Opfern sexualisierter Gewalt zu tun haben. Darin müsse darüber aufgeklärt werden, was Traumata mit einer Person machen und wie eine Retraumatisierung verhindert werden kann.
Doch genau eine solche Schulung fehlt in vielen Kantonen. Es gibt keine einheitlichen schweizweiten Vorgaben dazu, keine bundesweiten obligatorischen Kurse zum Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die Angestellte bei der Polizei belegen müssen.
Zwar ist die Sensibilisierung zum Thema sexualisierte Gewalt fester Bestandteil der Grundausbildung aller Polizist*innen. In einigen Kantonen ist eine weiterführende Ausbildung ebenfalls obligatorisch. So etwa in Graubünden, wie die Medienstelle dort mitteilt. In Zürich und Bern gibt es einen Pikettdienst, der auf die Befragung und Betreuung von Betroffenen sexualisierter und häuslicher Gewalt spezialisiert ist. Auch bei der Polizei Basel-Stadt sei man sich der Herausforderung bewusst, heisst es auf Anfrage. Das Korps werde im Rahmen von obligatorischen Schulungen und Themenausbildungen weitergebildet.
In anderen Kantonen hingegen sind Weiterbildungen nicht verpflichtend. Im Kanton Uri etwa haben Mitarbeitende, die mit Opfern sexualisierter Gewalt zu tun haben, die Möglichkeit, sich in Kursen am Polizei-Institut in Neuenburg weiterzubilden – das ist jedoch freiwillig. Bei der Kantonspolizei Nidwalden sei der Umgang mit betroffenen von sexualisierter Gewalt Gegenstand interner Schulungen, wie die Medienstelle mitteilt. Es gibt jedoch keinen Pikettdienst, der auf das Thema spezialisiert ist.
Die einzelnen Sicherheitsdirektionen der Kantone entscheiden am Ende selbst, ob ein spezialisierter Pikettdienst rund um die Uhr verfügbar sein muss und ob Schulungen obligatorisch sind.
Viele der Weiterbildungen werden am Polizei-Institut in Neuenburg durchgeführt. Dort reagiert man auf Nachfragen jedoch abwehrend: Zu den genauen Inhalten der Grundausbildung und der Weiterbildungsmodule zum Thema sexualisierte Gewalt gibt der Leiter des Instituts keine Informationen. Er betont jedoch: „Das Thema sexualisierte Gewalt ist im Rahmen der Grundausbildung wichtig und wird behandelt.” Es gebe zudem ein Angebot an weiterführenden Kurse, zum Beispiel zum Thema „das Opfer im polizeilichen Ermittlungsverfahren” und zum Thema „Fachkurs Befragung und Kindsbefragung”.
Anja hatte sich beim Polizeiposten telefonisch angemeldet. Andere Betroffene von sexualisierter Gewalt wissen nicht, dass das möglich ist. Sie laufen dann zum Schalter, müssen einer fremden Person in Uniform von dem Erlebten erzählen – und erwischen, wenn sie Pech haben, eine Person, die weniger einfühlsam ist, wie es bei Anja der Fall war. Viele wissen auch nicht, dass sie das Recht darauf haben, von einer Frau befragt zu werden und von einer Vertrauensperson begleitet zu werden. So berichten es mehrere Vertreterinnen von Opferberatungsstellen.
In einem Artikel, der vergangenes Jahr in der Republik erschienen ist, schildern Betroffene von sexualisierter Gewalt, dass sie bei der polizeilichen Einvernahme nicht über ihre Rechte aufgeklärt wurden, dass ihnen ohne Einfühlungsvermögen und mit Misstrauen begegnet wurde. Für alle war die Einvernahme eine retraumatisierende Erfahrung.
Agota Lavoyer von der Fachstelle Opferhilfe Sexuelle Gewalt in Bern kennt solche Geschichten aus ihrer Arbeit. Sie sagt dazu: „Der Auftrag der Polizei kann nur erfüllt werden, wenn die Polizist*innen genügend geschult sind. Über die Dynamiken häuslicher und sexualisierter Gewalt und über Trauma und Traumafolgestörungen wie PTBS und dissoziativen Störungen, die grossen Einfluss auf die Einvernahmefähigkeit eines Opfers haben können.” Sie fügt hinzu: „Ich habe schon oft von Polizist*innen gehört, dass sie sich intensivere Schulungen wünschen würden, damit sie besser auf traumatisierte Opfer eingehen können.”
Am Ende gibt Anja den Behörden den Namen des Täters. Der Polizist nickt, der Mann sei ihnen bekannt. Anja fühlt sich unwohl, aber auch erleichtert. „Ich dachte, jetzt holen sie ihn.”
Doch man holt ihn nicht. Anja begibt sich in Therapie.
Bei der Staatsanwaltschaft
Später wird sie von der Staatsanwaltschaft zur Einvernehmung eingeladen. Dort erlebt sie die, wie sie sagt, demütigendste Episode der letzten eineinhalb Jahre. Die Anhörende habe die Hände hinter dem Kopf verschränkt und ihr immer wieder misstrauische Fragen gestellt.
Wieso sie nach der Vergewaltigung halbnackt zu dem Mann an der Tramhaltestelle gerannt sei, das tue man doch nicht nach so einem Erlebnis. Wieso sie die Tabletten genommen habe.
Anja musste sich immer wieder für ihre Erfahrung rechtfertigen. „Mir ist klar, dass man das hinterfragen muss, dass es eine Untersuchung ist”, sagt sie heute. „Aber dieses Gefühl, schuldig zu sein, hätte sie mir so nicht vermitteln müssen. Muss ich denn weinend in der Ecke liegen, damit man mir glaubt?”
Conny Jauslin von der Opferhilfe Basel kennt solche Berichte von Betroffenen: „Die Einvernahmen sind sehr belastend und es ist oft Glück, wie empathisch und geduldig die Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft ist. Zudem sind die Einvernahmen oft extrem lang.” Das wiederholte Abfragen der schlimmsten Szenen der Gewalt sei retraumatisierend. Das alles sei nicht opferfreundlich. Es brauche dringend Verbesserungen, insbesondere Schulungen, um diesen Prozess angenehmer zu gestalten.
Auch Corina Elmer von der Frauenberatung sexuelle Gewalt Zürich bestätigt: „Die Betroffenen werden mit einem Verfahren konfrontiert, das sie nicht erwarten. Viele wissen nicht, was alles auf sie zukommt, wenn sie zur Polizei gehen.”
Auf die Bitte nach Stellungnahme zu Anjas Geschichte antwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Basel: „Bestehen Zweifel an Aussagen eines Opfers, so müssen diese, wie bei anderen Delikten, hinterfragt werden, denn eine mögliche Verurteilung der Täterschaft ist nur möglich, wenn entsprechende Beweise bzw. Indizien vorliegen.”
Doch die Beweisführung arbeitet oft mit falschen Vorstellungen, sagt Agota Lavoyer von der Fachstelle Opferhilfe in Bern: „Es gibt eine sehr starke Vorstellung davon, wie sich ein typisches Opfer zu verhalten hat.” Es komme vor, dass ein Freispruch unter anderem mit dem Begriff des „kontraintuitiven Opferverhaltens” begründet wird, was impliziere, dass es ein intuitives Opferverhalten gibt. Also eine Art „Normalverhalten”, das von einem Opfer zu erwarten ist.
„Das ist einfach falsch.” Jedes Opfer sexueller Gewalt gehe auf individuelle Art mit dem Trauma um. Studien zeigten ausserdem, dass tatsächliches Verhalten konträr zu dem stehe, was man gesellschaftlich unter typischem Opferverhalten versteht: „Häufig übernachtet das Opfer noch beim Täter, es rennt nicht sofort davon und sucht ihn später mehrmals wieder auf.” Wie damals Anja.
Ebenso irritierend findet Lavoyer die starke Fokussierung der Gesellschaft auf das Opfer. „Täter sind in unserer Gesellschaft immer noch unsichtbar. Sie kommen in fast keiner Diskussion vor. Viel lieber wird über das Opferverhalten als über das Täterverhalten geredet. Täter kommen nicht mal im Begriff ‚Gewalt gegen Frauen‘ vor”, schrieb sie Mitte Januar in einem öffentlichen Facebook-Post. Mädchen und Frauen werde immer noch das Gefühl gegeben, sie müssten sich verändern, damit Männergewalt gestoppt werden könne, schreibt sie weiter.
„Um Erfahrungen wie die von Anja zu verhindern, braucht es mehr Schulungen für Fachpersonen, die mit Opfern arbeiten. Über sexualisierte Gewalt und über den Umgang mit traumatisierten Opfern”, sagt Lavoyer.
Dem stimmen Vertreterinnen von Opferhilfen aus anderen Städten zu. Im Kanton Zürich habe es zwar eine obligatorische Schulung für Staatsanwält*innen gegeben, sagt Corina Elmer. Doch das sei erst der Anfang. Auf dem Land sei dies oft noch nicht der Fall.
Im Kanton Obwalden zum Beispiel verfügt keine*r der Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft über eine Weiterbildung zur Befragung von erwachsenen Opfern sexualisierter Gewalt. Man greife dabei auf Spezialist*innen anderer Kantone zurück. Einzig für die Befragung von Minderjährigen, die Gewalt erfahren haben, müssen Mitarbeitende einen Weiterbildungskurs zum Thema Kindsbefragung belegen.
Bei den Staatsanwaltschaften anderer Kantonen, die das Lamm kontaktiert hat, ist den Medienstellen nicht bekannt, wieviele Personen genau eine Weiterbildung zum Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt absolviert haben. Insgesamt ist die Situation intrasparent und unübersichtlich.
Die Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft Solothurn sagt, die Mitarbeitenden würden regelmässig Weiterbildungen besuchen, teilt jedoch nicht mit, wo diese stattfinden, was ihr genauer Inhalt ist und welche davon obligatorisch sind. Die Medienvertreterin der Strafverfolgungsbehörde Zug betont, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug „grossen Wert” darauf lege, „dass solche Einvernahmen durch erfahrene Staatsanwältinnen durchgeführt werden, welche in der Regel Sexualdelikte zu ihren Kernkompetenzen zählen.” Und im Kanton Bern sagt der Medienvertreter, eine obligatorische Weiterbildung sei nicht nötig, da die Mitarbeitenden weiterführende Kurse auch freiwillig besuchen würden.
Einige Staatsanwält*innen besuchen Weiterbildungskurse an der Staatsanwaltsakademie, an der Uni Luzern. In den angebotenen CAS sind Sexualdelikte Teil des Programms. Insgesamt werden dem Modul Sexualdelikte im CAS II fünf Tage gewidmet.
Die Staatsanwältin und Dozentin an der Staatsanwaltsakademie in Luzern Géraldine Sarah Kipfer sagt: „Die Aufgabe von uns Staatsanwältinnen ist die Ermittlung”, das sei etwas ganz anderes als die Aufgabe etwa von Opferberatungsstellen. Sie räumt zudem ein: „Ein Staatsanwalt kann die beste Ausbildung haben, aber wenn er kein empathischer Mensch ist, hilft das in der Einvernahme nichts. Das gilt bei der Ermittlung von Delikten immer, nicht nur in der Einvernahme von Opfern sexualisierter Gewalt.”
Das CAS II, dass das Modul Sexualdelikte beinhaltet, ist für Staatsanwält*innen nicht schweizweit obligatorisch oder Bedingung für eine Anstellung.
Am Gericht
Es ist ein regnerischer Tag Anfang Februar und vor dem Strafgericht Basel stehen zwei Dutzend Menschen in Stille. Auf ihren Schildern steht: „I believe her” – Ich glaube ihr. Im Gericht hingegen steht Aussage gegen Aussage, hier gilt: im Zweifel für den Angeklagten.
Anja sitzt vor dem Richterpult an einem kleinen Tisch. Vor ihr sitzt der Richter, er ist Mitglied der EVP. Hinter Anja sitzen eine Staatsanwältin, ihre eigene Anwältin und die Verteidigung. Alle notieren genau, was Anja jetzt erzählt. Der Täter sitzt in einem anderen Raum und hört auch mit. Und erneut muss Anja die Ereignisse aus dieser Nacht vor eineinhalb Jahren beschreiben.
Auch die Gerichtsverhandlung ist schwer für Betroffene, sagt Conny Jauslin von der Opferhilfe Basel: „Man sitzt dann da nochmal nackt und zieht sich aus”, sagt sie. Und der Täter schaut per Video und oft mit Bildschirmübertragung zu. „Je nachdem, wie befragt wird, ein falsches Wort – das kann bei einer traumatisierten Person sofort etwas auslösen. Plötzlich denkt die Person, man glaube ihr nicht, sie werde angeschuldigt.” Das Gesetz wolle nur Beweise und Fakten, sagt Jauslin, es gehe nicht um die Person.
In schmerzhafter Detailgenauigkeit wird anschliessend über die Tat gesprochen, werden noch genauere Beschreibungen verlangt, wird kleinlich auf sexuelle Vorlieben der Beteiligten hingewiesen und auf scheinbaren Widersprüchen in Verhalten und Erzählung beharrt.
Es geht in der Verhandlung unter anderem darum, wie „normaler Sex” auszusehen habe. Anja muss den Anwesenden erklären, dass es sich nicht mehr um Sex, sondern um Vergewaltigung handelt, sobald eine Person leidet.
Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen, die beiden hätten es eben gerne etwas „härter”. Die verteidigende Anwältin verweist zudem auf vermeintliche Widersprüche in Anjas Erzählung. Redet vom „normalen Opferverhalten”.
Die Staatsanwaltschaft ist hingegen überzeugt von Anjas Erzählungen und dem Plädoyer ihrer Anwältin. Sie plädiert für vier Jahre Haftstrafe.
Ein Tag später verkündet der Richter das Urteil: schuldig. Anjas Erzählungen bezeichnet das Gericht als nachgewiesen. Die Version des Täters hingegen sei nicht glaubhaft. Er wird zu 28 Monaten Haft verurteilt, 14 davon auf Bewährung.
„Das ist zu wenig”, sagt Anjas Anwältin am Tag nach der Urteilsverkündung. Sie sei mit dem Urteil unzufrieden und könne es nicht nachvollziehen. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre gefordert. Sie geht in Berufung.
Die Begründung des Gerichts für das milde Strafmass: Es hätte viel schlimmer sein können. Er hätte sie etwa noch öfter vergewaltigen oder einsperren können. Er sei zudem zum ersten Mal in ein Gewaltdelikt verstrickt.
Dabei wurde gegen ihn schon einmal Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Das Verfahren wurde damals eingestellt. Der Täter sagt vor Gericht selbst, er dominiere Frauen gerne.
„Schlimm ist für die Betroffenen ein Freispruch”, sagt Corina Elmer von der Frauenberatung Zürich. „Es geht vielen Opfern hauptsächlich darum, dass anerkannt wird, dass ihnen Unrecht getan wurde. Auf einer symbolischen Eben bedeutet es trotzdem eine erneute Verletzung, wenn die angeschuldigte Person nur eine geringe Strafe bekommt.”
Anja musste 17 Monate auf dieses Urteil warten. Am Tag des Urteils ist sie nicht anwesend. Sie hat am Tag zuvor all ihre Notizen und Erinnerungsstützen zum Fall verbrannt.
*Name von der Redaktion geändert.
Diese Recherche entstand in Zusammenarbeit mit dem Onlinemagazin Bajour. Dort ist vor zwei Wochen Anjas Geschichte erschienen. Der Text in das Lamm soll die strukturellen Gründe hinter Anjas Erlebnissen ausführen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?