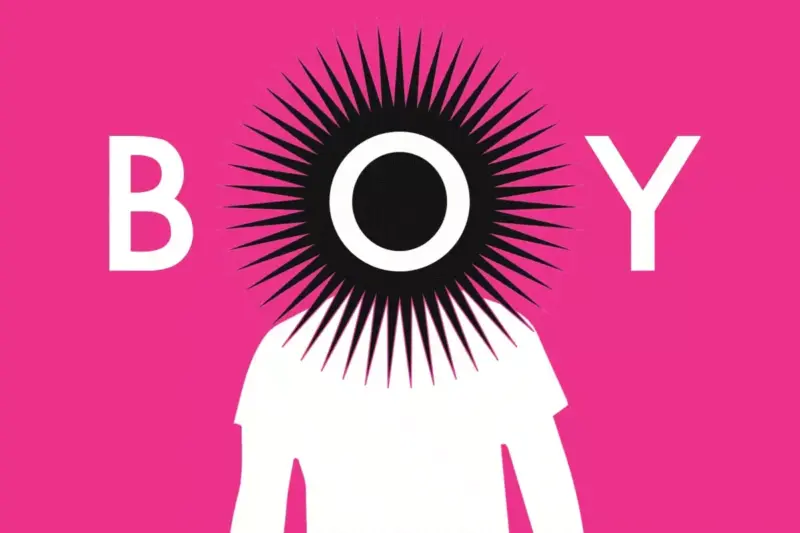Die vor kurzem erschienene Anthologie Oh Boy wollte literarische Texte über Männlichkeit mit kritischen Reflexionen verbinden. Im Beitrag des Herausgebers Valentin Moritz ging es dabei auch um einen sexuellen Übergriff, den er selbst begangen hatte. Nachdem öffentlich wurde, dass die reale Betroffene von Moritz‘ Gewalt ihm explizit verboten hatte, den Übergriff literarisch zu verwerten, aber Moritz mit der Veröffentlichung ein weiteres Mal ihr Nein überging, gab es heftige Kritik und Boykottaufrufe. Der Verlag hat das Buch nun vorerst vom Markt genommen.
Doch der Skandal reisst nicht ab: In einem kurz darauf erschienenen Interview hat Mitherausgeber*in Donat Blum das Vorgehen von Moritz aggressiv verteidigt, inklusive sexistischer Ausfälle. Viele stellen sich jetzt die Frage: Wie viel reaktionärer Maskulismus steckt eigentlich in diesen heutigen Versuchen, sich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen?
Maskulismus, auch oft Maskulinismus, ist ein von sogenannten Männerrechtlern geprägter Begriff, der sich als Pendant zum Feminismus versteht. Der Maskulismus versteht das männliche Geschlecht als systematisch benachteiligt oder sogar von Frauen unterdrückt.
Valentin Moritz und die Suche nach authentischer Männlichkeit
Wer Moritz‘ Text aus Oh Boy wirklich liest, muss feststellen, dass seine Täterschaft dort nicht mal eine wirklich wichtige Rolle spielt. Wie schon der Titel „Ein glücklicher Mensch“ andeutet, interessiert sich Valentin Moritz vor allem für eins: Valentin Moritz selbst. Die zentralen Themen des Beitrags sind die Suche nach einem authentischen Zugang zur eigenen Identität und Männlichkeit, sowie die Sehnsucht nach unverfälschter Nähe zu einem männlichen Freund.
Dass Moritz sich selbst und das eigene Schaffen für wichtiger hielt als den Willen der Betroffenen seiner Gewalt, erscheint da nur konsequent.
Wenn der Autor über seine Täterschaft spricht, nimmt er sie meist nur als Ausgangspunkt für weitere pathethische Selbstbefragungen á la: „Wie soll ich wissen, ob dieser Text ehrlich ist? Ob ich ehrlich bin, selbst wenn ich mich bemühe.“ Dabei ahnt Moritz sogar selbst, dass sein Schreiben vielleicht „nur eine weitere hohle Attrappe am ausgedehnten Strand der männlichen Selbstdarstellung“ ist. Konsequenzen zieht er daraus freilich nicht.
Sexualisierte Gewalt als ein Problem, das man kritisch verstehen und vor allem praktisch angehen muss, verschwindet bei Valentin Moritz fast vollständig hinter dem Kreisen um die eigenen ambivalenten Gefühle gegenüber der eigenen Männlichkeit. Dass Moritz sich selbst und das eigene Schaffen für wichtiger hielt als den Willen der Betroffenen seiner Gewalt, erscheint da nur konsequent.
Der „warme Blick auf Männlichkeit“
Moritz‘ Suche nach männlicher Authentizität erinnert tatsächlich weniger an feministische Reflexion als an mythopoetischen Maskulismus: Die Mythopoeten, eine Fraktion der Männerbewegung, die in den 80er Jahren entstand, wollten durch Innerlichkeit und Verbrüderungsrituale eine „tiefe Männlichkeit“ freilegen und Männer so von ihrer „toxischen Männlichkeit“ heilen.
Richtig gelesen: „Toxische Männlichkeit“ ist eigentlich kein feministischer Begriff, sondern ein Konzept des Mythopoeten Shepherd Bliss. Seine ursprüngliche Bedeutung war, dass Männer vor allem Opfer der Gesellschaft sind und männliche Gewalt ein Ergebnis von Defiziten ist, nicht von patriarchaler Herrschaft.
Für die Causa Oh Boy ist das gleich doppelt relevant. Denn im Nachwort der Publizistin Mithu Sanyal bezieht sie sich explizit und positiv auf Bliss. Sanyals Gedanken zu „toxischer Männlichkeit“ heute sind dabei ganz im Sinne des Erfinders: Männer würden viel zu einseitig als Täter und zu wenig als Betroffene von einengenden Anforderungen und Bildern begriffen. Sanyal, die 2019 einen Beitrag im Buch des deutschen Maskulisten Arne Hoffmann über „ganzheitliche Geschlechterpolitik“ veröffentlichte, lobt Oh Boy in ihrem Nachwort für seinen „warmen Blick auf Männlichkeit“.
Doch genau dieser Blick scheint nicht nur im Fall von Moritz zu maskuliner Gefühligkeit statt feministischer Reflexion geführt zu haben. So schreibt der Literaturwissenschaftler Peter Hintz in seiner Rezension der Anthologie: „Bei vielen Texten in Oh Boy geht es gar nicht zuerst um männliche Selbsthinterfragung, die auch Antworten hervorbringen soll, sondern um emotionale Expressivität, also den Ausdruck von möglichst viel Selbstmitleid oder Schuldgefühlen bis hin zum Kitsch.“
Maskulismus vs. kritische Männlichkeit
Wichtige Differenzen zwischen Mythopoeten und dem Ansatz der „kritischen Männlichkeit“, mit dem auch Oh Boy assoziiert werden will, gibt es natürlich trotzdem: Auch wenn heutige Mythopoeten, wie der Männercoach John Aigner, Feminismus als Inspiration angeben – das Ziel der Mythopoeten war und ist es nie gewesen, geschlechtliche Emanzipation zu erreichen. Sie suchen „echte“ Männlichkeit und diese wollen sie unter Männern und in der Männlichkeit selbst finden. Deshalb landen sie am Ende stets bei Sexismus und kruder Männerbündelei.
„Kritische Männlichkeit“ hingegen will pro-feministisch sein: Feminismus wird nicht nur eine Inspiration sein, sondern der zentrale Ausgangspunkt. Männer sollen andere und bessere Männer werden, nicht unabhängig vom Feminismus, sondern gerade wegen ihm. Man muss die eigene Männlichkeit ändern und einbringen, aber nur, wenn sie der Gleichberichtigung einen Dienst erweist.
In Boys don’t cry von Jack Urwin, dem Klassiker der neuen, diesmal pro-feminstischen Kritik an toxischer Männlichkeit von 2017 heisst es: „Wahre Männlichkeit ist etwas, was ihr euch verdienen müsst, indem ihr euer Gender so nutzt, dass alle etwas davon haben.“
Ironischerweise haben die Oh Boy Herausgeber*innen Blum und Moritz genau das erreicht, was sie sich vorgenommen haben: einen authentischen Einblick in feministisch inspirierte Männlichkeiten heute – im allerschlechtestens Sinne.
Hören Männer also auf, ignorant um sich selbst zu kreisen, wenn ihre Suche nach „wahrer Männlichkeit“ pro-feministisch gerahmt wird? Der Beitrag und das Verhalten von Valentin Moritz sprechen stark dagegen. Auch mit explizit feministischer Basis hat „kritische Männlichkeit“ anscheinend doch mehr mit Maskulismus zu tun, als einem lieb sein kann.
Die neueren Ausfälle von Mitherausgeber*in Donat Blum sind nur weitere Beweise dafür.
Donat Blum und der kritisch-männliche Hass auf feministische Kritik
In einem neueren Interview vom 25. August weist Blum alle Vorwürfe gegen Moritz, den Verlag und *ens von sich. Nie sei ein „Nein“ ignoriert worden, zumindest nach allem, was Blum weiss – womit wahrscheinlich gemeint ist: was Valentin Moritz *ens erzählt hat. Ausserdem gelte in einer Demokratie ja immer noch die Unschuldsvermutung! Den feministischen Standard der Definitionsmacht, der Betroffenen von männlicher Gewalt die Deutungshoheit über ihr Erleben zugesteht, scheint Blum nicht zu kennen.
Donat Blum hat eine nicht-binäre Geschlechtsidentität und benutzt das Neopronomen *ens, anstatt z.B. er/ihn oder sie/ihr.
Blums Argumentation ist aber nicht einfach nur unfeministisch – was für einen Menschen, der sich „queer-feministische Solidarität“ auf die Fahnen schreibt, irritierend genug wäre. Sie überschreitet auch die Grenze zu Antifeminismus und misogynen Untertönen. Zum Beispiel da, wo Blum einen vagen Verweis auf die intime Beziehungsgeschichte von Moritz und der Betroffenen als wichtigen Fakt platziert. Denn so spielt *ens entweder fahrlässig oder bewusst auf die patriarchale Vorstellung an, wonach kein oder zumindest kein schlimmer Übergriff stattgefunden haben kann, wenn die Frau schon mal Sex mit dem Mann gehabt hat.
Oder dort, wo Blum allen Ernstes behauptet, dass es falsch und sogar patriarchal sei, Männer vor allem als Täter zu sehen. Wenn man „ehrlich“ sei, wären ja auch Männer Opfer und Frauen Täter. Zumindest wenn man psychische Gewalt berücksichtigen würde – und so das eigentliche Thema, sexuelle Gewalt, unter den Tisch fallen lässt.
Diese dreiste Täter-Opfer-Umkehr hatte Blum in einem mittlerweile unverfürgbaren Instagram-Statement sogar noch auf die Spitze getrieben: Nicht *ens, Moritz und der Kanon Verlag hätten dem „Patriarchat in die Hände gespielt“, sondern die feministische Kritik an ihnen. Diese stellt Blum auch in dem neuen Interview als übertrieben, manipulativ und sogar gewaltvoll dar.
„Kritische Männlichkeit“ nähert sich besonders dann dem Maskulismus an, wenn es hart auf hart kommt.
Blum wurde in den letzten Wochen zu einem besonders enthemmten Beispiel für den kritisch-männlichen Umgang mit feministischer Kritik. Anders als im Maskulismus wird Feminismus hier weder fern gehalten noch prinzipiell als Feind begriffen. Im Gegenteil: Als Stichwortgeber und Antrieb für die eigene Auseinandersetzung darf und muss er sogar herhalten.
Doch wirkliche Kritik – vor allem die, die einen selbst trifft und nicht positiv integriert werden kann – verbittet man(n) sich dann doch. Deshalb nähert sich „kritische Männlichkeit“ besonders dann dem Maskulismus an, wenn es hart auf hart kommt. Statt einem echten Hinterfragen des eigenen Handelns folgt nämlich oft wieder nur altbekannter sexistischer Furor. Und so wird Feminist*innen im Allgemeinen und den Betroffenen von männlicher Gewalt im Besonderen Hysterie, wenn nicht gleich ein infamer Zerstörungswillen, unterstellt – nur diesmal mit einer extra Portion Selbstveropferung der gefallenen pro-feministischen Helden.
Männlichkeit ist nicht der Massstab
Ironischerweise haben die Oh Boy Herausgeber*innen Blum und Moritz genau das erreicht, was sie sich vorgenommen haben: einen authentischen Einblick in feministisch inspirierte Männlichkeiten heute – im allerschlechtestens Sinne.
Denn die historischen und aktuellen Ansätze der männlichen Auseinandersetzung mit Männlichkeit haben stets aufs Neue bewiesen, dass Männer von der Frage angetrieben sind, wie sie noch Männer sein können, obwohl es feministische Kritik gibt. Stattdessen sollten sie sich fragen, wie sie an feministischer Kritik und Bewegung teilhaben und diese unterstützen können, obwohl sie Männer sind. Das Problem liegt eben schon im Massstab der (neuen) Männlichkeit.
Denn dass einzelne Menschen, vor allem (cis) Männer, sich und ihr Verhalten verändern müssen, ist eine schlichte Notwendigkeit im Angesicht der patriarchalen Zustände. Die Frage, ob das, was daraus entsteht, noch Männlichkeit genannt werden kann, ist nicht von Interesse. Man(n) sollte sie zurückweisen, statt ständig zu versuchen, neue, positive Antworten auf sie zu finden. Solange das aber nicht geschieht, wird die Auseinandersetzung mit Männlichkeit immer mehr mit Maskulismus als mit Feminismus gemein haben.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?