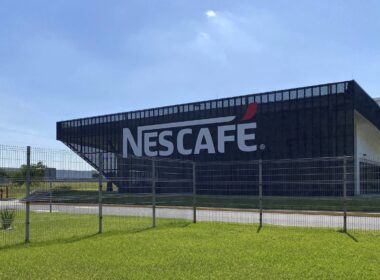Das Lamm: Frau Küttel, Sie sind Co-Geschäftsleiterin der Kleinbauern-Vereinigung, eines Vereins, der sich nach eigenem Bekunden für die Interessen kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe einsetzt. Am 13. Juni werden zwei Initiativen zur Abstimmung kommen, die deutlich in die Landwirtschaftspolitik der Schweiz eingreifen. Wie positioniert sich ihr Verband dazu?
Barbara Küttel: Das ist ganz einfach. Die Kleinbauern-Vereinigung hat eine Ja-Parole für die Pestizid-Initiative (PI) und Stimmenfreigabe für die Trinkwasserinitiative (TWI) beschlossen.
Beide Initiativen werden oft inhaltlich in einen Topf geworfen. Wo liegen für Sie die wichtigsten Unterschiede?
Wir setzen uns für die PI ein, weil sie ein ganz simples Ziel hat: das Verbot synthetischer Pestizide. Der Pestizidbegriff ist dabei sehr klar formuliert. Es geht um synthetische Pestizide, die im biologischen Landbau, den wir fördern wollen, ohnehin nicht verwendet werden. Der zweite wichtige Punkt ist: Das Verbot wird nicht nur für die Landwirtschaft gelten, sondern auch für alle anderen Pestizidanwender:innen, zum Beispiel im privaten und kommerziellen Gartenbau oder auch bei der SBB. Die Bäuer:innen werden also gleich wie alle anderen Anwender:innen behandelt.
Und bei der TWI ist das nicht der Fall?
Die TWI hat im Wesentlichen die gleiche Stossrichtung. Das finden wir begrüssenswert. Sie will das Ziel der Pestizidfreiheit aber nicht durch ein generelles Verbot erreichen, sondern verfolgt einen liberaleren Ansatz. Die Steuerung soll über das Streichen von staatlichen Geldern für gemeinwirtschaftliche Leistungen, sogenannte Direktzahlungen, geschehen. Nur noch Landwirt:innen, die auf Pestizide verzichten, werden von den Direktzahlungen profitieren.
Die „Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide“, kurz Pestizid-Initiative (PI), fordert ein generelles Verbot synthetischer Pestizide in der Schweizer Landwirtschaft. Synthetische Pestizide definiert der Initiativtext als Mittel mit einer in der Natur nicht vorkommenden chemischen Zusammensetzung. Nicht vom Geltungsbereich betroffen, heisst es, „sind Bio-Hilfsstoffe, biologische Pestizide, Nützlinge, organische, mechanische, elektrische sowie thermische Pestizide und alle anderen Alternativen, die keine chemischen Giftstoffe enthalten.“ Das Anwendungsverbot soll mit einer Frist von zehn Jahren umgesetzt werden und erstreckt sich auch auf importierte Lebensmittel, womit gleiche Wettbewerbsbedingungen für schweizerische und ausländische Produzent:innen garantiert werden sollen.
Die „Initiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz“ (TWI) zielt auf eine Reduktion von Pestiziden und Antibiotika in der Landwirtschaft und fordert im Initiativtext einen Tierbestand am Hof, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann. Diese letzte Forderung wurde bereits abgeschwächt. Nun ist nur noch die Rede von einem Tierbestand, der mit Schweizer Futter ernährt werden kann. Regionaler Futterhandel würde also möglich bleiben. Im Gegensatz zur PI sollen die Ziele nicht über ein generelles Verbot, sondern über strukturellen Zwang durch die Streichung staatlicher Gelder, der sogenannten Direktzahlungen, erreicht werden. Die Umsetzungsfrist beläuft sich auf acht Jahre.
Wo liegt das Problem?
Direktzahlungen sind Gelder vom Staat, die Betriebe bekommen, wenn sie sich an bestimmte ökologische Standards halten, die im sogenannten Ökologischen Leistungsnachweis festgeschrieben sind. Gerade stark spezialisierte Betriebe, die relativ viele synthetische Pestizide einsetzen, wie zum Beispiel im Gemüseanbau, kriegen schon jetzt wenige Direktzahlungen. Wenn man diesen Betrieben Direktzahlungen kürzt, stört es sie kaum. Die Steuerungswirkung wäre in diesem Fall also nicht zwingend gegeben. Gleichzeitig wären vielfältige Betriebe, die stärker auf Direktzahlungen angewiesen sind, vermehrt betroffen.
Hier kommen wir auf eine verbreitete Kritik an der TWI zu sprechen. Es heisst, dass gerade Biolandwirt:innen geschädigt werden, weil sie proportional mehr Direktzahlungen bekommen. Wenn die Subventionen wegfallen, könnten sie gezwungen sein, auf den profitableren konventionellen Landbau umzusteigen. Sehen Sie diese Gefahr?
Möglich wäre es, aber das hängt sehr vom einzelnen Betrieb ab. Ein klassischer Mischbetrieb, konventionell oder bio, mit verschiedenen Betriebszweigen, wird nicht aus den Direktzahlungen aussteigen. Sie bilden einen zu wichtigen Anteil an den jährlichen Einnahmen.
Gibt es noch weitere Probleme mit der TWI?
Ein anderer Aspekt sind die Futtermittelimporte. Die TWI fordert zusätzlich, dass nur noch auf dem Hof selbst produziertes Futter verfüttert werden darf. Damit zielt sie auf den problematisch hohen Import von energie- und eiweissreichen Futtermitteln aus dem Ausland ab, wie sie bei der Hühner- und der Schweinemast in grossen Mengen verwendet werden. Nun gibt es aber auch kleine Betriebe mit wenig Fläche, die ebenfalls auf Hühner- oder Schweinemast setzen. Wenig Fläche bedeutet, dass kaum Eigenfutter verwendet wird. Und diese Betriebe wären bei einer strengen Auslegung der TWI natürlich stark betroffen.
Ist diese strikte Auslegung zu erwarten?
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Die Forderung wurde von den Initiant:innen schon im Vorfeld aufgeweicht, sodass ein regionaler Futterhandel sicher weiterhin möglich bleiben würde.
Das heisst, die TWI bietet grössere Herausforderungen auch für kleinere oder vielfältige Betriebe. Was macht die PI besser?
Das grundsätzliche Verbot von synthetischen Pestiziden hiesse – im Gegensatz zur Direktzahlungskürzung – dass alle gleichermassen auf diese Mittel verzichten müssten. Darum sehen wir die PI ganz klar als Zukunftsperspektive für Kleinbetriebe, die sich über reine Effizienz nicht profilieren können, wohl aber über Qualität und Naturnähe. Im Gegensatz zur TWI werden bei der PI ausserdem auch importierte Produkte berücksichtigt. Auch sie müssen in Zukunft ohne synthetische Pestizide hergestellt worden sein. Das bedeutet: gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Lebensmittelproduzent:innen hier und im Ausland sowie keine Verlagerung der Umweltschäden ins Ausland.
Ist ein allgemeiner Umstieg auf biologischen Pflanzenschutz denn überhaupt für alle Bereiche möglich?
Es gibt sicher Anbaumethoden und Kulturen, wo es etwas schwieriger wird. Das Beispiel Rosenkohl wird oft genannt. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Man muss versuchen, über neue biologische Mittel oder über die Pflanzenzucht zu besseren Ergebnissen zu kommen. Gute Pflanzenzucht ist längerfristig sowieso ein Schlüssel zur Reduktion chemischer Pestizide. Die Initiativen lassen aus diesem Grund zehn (PI) bzw. acht (TWI) Jahre Zeit für die Umsetzung.
„Das Gemüse muss heute perfekt aussehen. Wenn man hier die Ansprüche verändert, werden gewisse chemisch-synthetische Mittel überflüssig.”
– Barbara Küttel, Kleinbauern-Vereinigung
Und dann sollte natürlich auch der Handel Einfluss nehmen, indem die Ansprüche etwas zurückgeschraubt werden. Heute geht es da sehr stark um optische Kriterien. Das Gemüse muss perfekt aussehen. Das hat aber mit Geschmack und Nährwert nichts zu tun. Wenn man hier die Ansprüche verändert, werden gewisse chemisch-synthetische Mittel überflüssig.
Könnte es bei völligem Verzicht auf synthetische Pestizide trotzdem zu Ernteausfällen kommen?
Es gibt immer das Risiko von Ernteausfällen. Aber mit solchen Entwicklungen muss man umgehen und darf nicht immer irgendein chemisch-synthetisches Zaubermittel erwarten.
Wie ginge man konkret damit um?
Eine Lösung ist, dass man auf verschiedene Kulturen setzt. Oder, wie wir es nennen: Das Risiko diversifizieren und den Hof vielfältig gestalten, damit man nicht in die Monokulturfalle tappt und am Ende ohne Chemie gar nicht mehr auskommt. Ausserdem haben kleinere diversifizierte Betriebe den Vorteil, dass mehr durch Handarbeit gemacht wird, sodass man bei Problemen schnell reagieren kann. Das geht auf einem grossen und wenig diversen Betrieb nicht so einfach, weil er hoch spezialisiert ist und verhältnismässig wenig Personal hat.
Gegen beide Initiativen wird gerne ins Feld geführt, dass sie regionale Produkte verteuern. Stimmt das?
Natürlich sind Bioprodukte ein bisschen teurer. Aber würde man mit richtigen Preisen rechnen, die auch die Umweltkosten enthalten, sähe es ganz anders aus. Dann wären Bioprodukte immer günstiger als konventionelle. Heute wird die Differenz indirekt über Steuern und Umweltkosten beglichen, die zum Beispiel beim Trinkwasser entstehen, weil es in gewissen Gebieten intensiv gereinigt werden muss, mit millionenteuren Anlagen.
Wie würde die Kleinbauern-Vereinigung im Weiteren vorgehen, wenn beide Initiativen angenommen würden?
Wir werden uns mit unserem Präsidenten, der auch im Nationalrat ist, dafür einsetzen, dass die Initiativen ihre Ziele auf einem realistischen Weg erreichen können und Landwirt:innen die notwendige Unterstützung erhalten. Dafür müsste man die Forschung intensivieren und die Direktzahlungen entsprechend umlagern. Neben dieser bäuerlichen Perspektive ist für uns von der Kleinbauern-Vereinigung aber auch die Konsument:innenseite sehr wichtig.
Wie ist das zu verstehen?
Es ist eine schiefe Vorstellung, dass nur die Bäuer:innen bestimmen sollen, wie produziert wird, allein wegen der vielen Gelder, die in die Landwirtschaft fliessen. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess und den müssen wir gemeinsam gestalten. Anders gesagt: Es kann ja nicht nur darum gehen, an der Produktion zu drehen, wenn die Nachfrage die gleiche bleibt. Und darum verstehen wir uns als Konsument:innen- und Bäuer:innenorganisation. Wir versuchen also, beide Seiten zusammenzubringen.
Pestizide wirken sich nicht nur auf die Umwelt aus, sondern auch direkt auf die Bäuer:innen, die damit umgehen müssen. Gibt es Erkenntnisse zu Gesundheitsschäden durch Pestizide?
In der Schweiz wurden da leider nie Zahlen erhoben. Das ist in anderen Ländern ganz anders. In Frankreich ist zum Beispiel Parkinson als Berufskrankheit von Landwirt:innen anerkannt. In gewissen Ländern werden alle Bäuer:innen, die aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus kommen, erst mal auf antibiotikaresistente Bakterien getestet. Daran sieht man, dass das Thema in anderen Ländern viel aufmerksamer angegangen wird als in der Schweiz.
Wenn es auch keine offiziellen Zahlen gibt: Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Pestiziden?
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, den mein Bruder jetzt als Biobetrieb leitet. Mein Vater hat früher konventionell angebaut und dabei auch chemisch-synthetische Pestizide eingesetzt, die er meistens ohne jeden Schutz ausgebracht hat. Auf der Landwirtschaftsschule wird der Einsatz dieser Mittel seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich gelehrt. Alternativen sind dabei immer noch viel zu wenig Thema. Und das sollte heute nicht mehr sein. Dass darüber gesprochen wird, ist schon ein erster kleiner Erfolg der beiden Initiativen.
Sollten sie am Ende trotzdem an der Urne scheitern: Wie wird es dann weitergehen?
Wir hoffen natürlich auf ein möglichst gutes Resultat. Denn es ist ja klar, dass das Thema damit nicht abgeschlossen sein wird. Es gibt zu viele Bereiche in der Landwirtschaft und Ernährung, die angepackt werden müssen. Darum wird es sicher zu weiteren Abstimmungen und Initiativen kommen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?