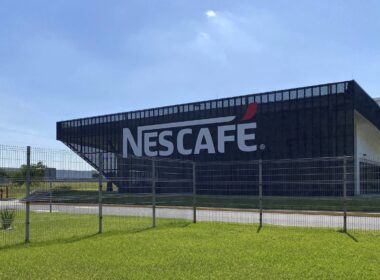Es funkt, raucht und knallt. In einer alten Werkhalle in der Strasse Atuel in Buenos Aires wird aus Stahl ein kleiner Wasserturm gebaut. Männer mit Tattoos und Narben im Gesicht laufen herum, schneiden und schweissen die Metallstangen zusammen. Die Werkhalle ist alt, etwas heruntergekommen, der Boden schwarz vor Dreck, doch an der Wand ganz hinten im Raum erstrahlt die Wandmalerei einer zerbrochenen Eisenkette, daneben der Name: Zweigorganisation der Freigelassenen und ihrer Familien, Teil der Bewegung der ausgeschlossenen Arbeiter*innen, kurz MTE.
Gleich daneben steht eine der wenigen Frauen. Nora Calandra wirkt trotz ihrer kleinen Figur imposant, ihr Auftreten selbstsicher. Bei ihrer Ankunft in der Werkhalle wird sie freudig begrüsst, man kennt und mag sich.
Die Menschen hier verbindet eine abgesessene Gefängnisstrafe, in manchen Fällen von wenigen Jahren, in anderen von über einem Jahrzehnt. Es sind Geschichten der Armut, der Not, aber auch der Suche nach Adrenalin, die sie in Haft gebracht hatten. Der Ausweg, er führt über eine Arbeit, soziale Netze, Freundschaften und gegenseitige Hilfe. Und das alles finden sie hier, in dieser einfachen Halle.
Sie ist vor mehr als vier Jahren Ausgangspunkt gewesen für die genossenschaftliche Bewegung ehemaliger Gefangener, die gemeinsam aus dem Zirkel der Gewalt ausbrechen wollten. Sie schufen zuerst für sich und dann für andere eine neue Realität. Heute planen sie, die staatliche Resozialisierungspolitik mitzugestalten.
Von Räubern und Banditen
Alles begann vor etwa vier Jahren mit José Ruiz. Der kleine, stämmige Mann, dessen Auftreten einen ganzen Raum füllt, sass über zehn Jahre im Gefängnis. Weshalb, das soll hier nicht stehen, zu häufig hole ihn seine die Vergangenheit bei Gesprächen ein. Von Bedeutung sei das Heute, denn heute ist Ruiz die wichtigste Person hinter dem Projekt ehemaliger Gefangener.
Ruiz sitzt hinter seinem Bürotisch in einem einfachen Haus in Pilar, einem ärmeren Vorstadtort von Buenos Aires. Es war das Grundstück seiner Familie, doch mit der Zeit wurde es zum zentralen Büro und Treffpunkt für die ehemaligen Gefangenen, die sich in verschiedenen Genossenschaften organisieren.
Menschen gehen aus und ein, sie begrüssen Ruiz, flüstern ihm ins Ohr und gehen weiter. Von nebenan kommen laute, etwas frustrierte Stimmen, der Preis für Mehl sei zu hoch, meint die eine Person, wie soll man so für den Verkauf des fertigen Brotes noch Geld verdienen, ergänzt die andere. Ruiz blickt in Richtung der Tür und meint lächelnd: „Auch das ist ein Teil der Selbstorganisation.”

Allein in der Vorstadt Pilar arbeiten rund 200 Personen. Es gibt Schweissereien, Schreinereien, Bäckereien und Recyclingstationen, die alle von ehemaligen Gefangenen als Genossenschaften geführt werden. Man arbeitet gemeinsam und verteilt am Ende der Woche den Gewinn. Nebenbei gibt es auch soziale Betreuung, doch dazu später mehr.
„Es geht um die Hilflosigkeit, die du hast, wenn du aus dem Gefängnis kommst”, erzählt Ruiz. Denn wer in Argentinien aus dem Gefängnis freikommt, ist auf sich allein gestellt. Die ehemaligen Häftlinge finden keine Arbeit, keine Wohnung und keine sozialen Kontakte. Meist kehren sie in eine zerrüttete Familie zurück. Oft zerbrechen diese Familien unter der Last, eine Person im Gefängnis zu begleiten, denn aufgrund korrupter Gefängnisdirektoren müssen meist sie sich um die Verpflegung der Häftlinge kümmern, so Ruiz.
Versorgende werden während der Zeit im Gefängnis zu Versorgten. Man wird zur Last und bekommt dies bei der Rückkehr zu spüren. Eine Rückkehr zur Kriminalität ist bei vielen der einfachste Ausweg. Staatliche Hilfeleistungen zur Wiedereingliederung gibt es kaum. Da niemand aus dem Zirkel der Gewalt ausbricht, wächst die eingesperrte Bevölkerung stetig. Auf den Jahreswechsel von 2019 auf 2020 waren laut offiziellen Zahlen 100’634 Personen in Gefangenschaft, 75 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Und so sitzen derzeit in Argentinien pro 100’000 Personen 243 in einem Gefängnis. In der Schweiz liegt die Zahl bei 73.
José Ruiz hat all dies am eigenen Leib erlebt. Er suchte Hilfe bei der Lokalverwaltung, doch mehr als Lebensmittelpakete konnten sie ihm nicht geben. Er hatte kurzzeitig einen guten Job, bis er seinen Strafregisterauszug nachreichen sollte: „Sie sahen mich an, fragten mich, warum ich gelogen hatte und warfen mich raus”, erzählt der 39-jährige. Er begann zu stehlen und kam ein weiteres Mal ins Gefängnis.
Noch während seiner zweiten Gefangenschaft beginnt er mit Freunden T‑Shirts zu bedrucken und an Unternehmen zu verkaufen – mit einem Handy übernimmt er aus der Zelle den Vertrieb, die schon freigelassenen Kollegen die Produktion. In Atuel bietet man den ehemaligen Häftlingen eine Werkstatt an. Noch im Gefängnis verdient er Geld und kann seinen Mitgefangenen regelmässig einen Grillabend spendieren. Als er schliesslich freikommt, hat er direkt einen geregelten Arbeitsalltag und bereits ein Einkommen. Diese Erfahrung macht er heute zum Vorbild.
Nach einiger Zeit bot die MTE Ruiz an, sich innerhalb der Basisorganisation um die ehemaligen Gefangenen zu kümmern. Die MTE ist ursprünglich aus Kartonsammler*innen entstanden, die sich gegen staatliche Verfolgung und für bessere Arbeitsbedingungen zusammenschlossen. Heute ist es eine genossenschaftliche Bewegung, in der sich prekarisierte Arbeiter*innen vereinen und gemeinsam produzieren – sei es auf dem Land, dem Recycling, beim Nähen oder Schreinern.
Ruiz lächelt und erzählt, dass sie sich nach längeren Gesprächen dafür entschieden hatten, eine eigene Zweigorganisation zu gründen, organisatorisch getrennt von den anderen Genossenschaften. Denn, so Ruiz, „Freigelassene haben eigene Bedürfnisse, du kommst psychologisch total kaputt aus dem Gefängnis und brauchst unbedingt eine spezielle Begleitung”.
In ihrem Weg werden die Freigelassenen eng von Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und Sozialwissenschaftler*innen betreut, wie die Bäckereigenossenschaft im Nebenraum. Hortensia Fleitas, eine Sozialarbeiterin sitzt neben den frustrierten Mitgliedern. Nach der hitzigen Sitzung erzählt sie, sie sei da, um der Gemeinschaft bei der Lösung von Problemen zu helfen, aber auch, um sich um ganz alltägliche Themen zu kümmern, wie zum Beispiel das Beantragen eines Personalausweises.
Ruiz schätzt diese Arbeit sehr. Auch weil viele Gefangene sehr individualistisch aus der Haft kommen: „Im Gefängnis kümmerst du dich um dich selbst, die Gemeinschaft hat keine Bedeutung.” Er meint: „Die Akademiker*innen sollen begleiten, helfen und unterstützen, aber leiten tun wir, wir wissen am besten, was wir brauchen.” Im Gegensatz zu vielen anderen sozialen Projekten sollen hier die Betroffenen selbst entscheiden, was am besten für sie sei.
Geburt mit Fesseln
Der Gefängnisalltag und die Erzählungen sind geprägt von Männern. Doch auch die Anzahl an Frauen und trans Personen in argentinischen Gefängnissen wächst stetig. Die argentinische Behörde für die Wahrung der Menschenrechte bei Inhaftierten sprach im Jahr 2021 von 4526 „Frauen, Trans und Travesti”, die in den argentinischen Gefängnissen einsassen. Doppelt so viel wie noch 20 Jahre zuvor. Mehr als ein Drittel sitzt wegen Drogenbesitzes oder ‑handels ein, ein weiteres Viertel wegen Diebstahls.
Viele Frauen erleben sexualisierte Gewalt im oder ausserhalb des Gefängnisses. Expert*innen sind sich einig, dass gefangene Frauen unter einem noch grösseren gesellschaftlichen Ausschluss leiden als Männer.
Nora Calandra war eine von ihnen. Die Mittvierzigerin sitzt im Innenhof der Werkstatt von Atuel und erzählt ihre Lebensgeschichte. Es ist ihre Geschichte, meint sie, um nicht über Intimitäten und Probleme anderer zu sprechen. Es fällt vielen schwer, über ihre Erlebnisse zu reden. Noch weniger wolle man, dass sie weitererzählt werden.

Calandra versuchte als alleinerziehende Mutter, durch kleine Alltagsdelikte ihre Kinder durch den Alltag zu bringen. Im Jahr 2010 wurde sie erwischt und kam ins Gefängnis. Ein schockierendes Ereignis. Calandra erzählt: „Am Eingang eines Gefängnisses für Männer stehen die Frauen Schlange für den Besuch, beim Eingang eines Frauengefängnisses stehen auch nur Frauen, aber viel weniger. Die Männer sind in beiden Fällen abwesend.” Calandra wollte nicht, dass ihre Kinder und ihre Mutter sie im Gefängnis besuchen. Sie sollten ihre Mutter von ausserhalb in Erinnerung behalten, ohne Gitter und herabwürdigende Leibesvisitationen.
Nur ihr damaliger Partner kam sie hin und wieder besuchen. Während ihrer Haft wird Calandra schwanger und bringt im Jahr 2012 ihr drittes Kind zur Welt – angekettet an das Bett. Laut argentinischen Gesetzen dürfen gefangene Mütter ihre Kinder während der ersten vier Jahre bei sich haben. „Ich entschied mich, mein Kind zwei Jahre bei mir zu behalten, danach sollte es in Freiheit leben.” Die erneute Mutterschaft veränderte ihren Blick auf die eigene Zukunft, sie wollte von nun an für ein besseres Leben für sich selber und ihre Mitmenschen kämpfen, sagt Calandra.
Im Jahr 2016 kam sie aus dem Gefängnis. Alles hatte sich in den sechs Jahren Haft verändert: „Meine Töchter waren keine Kinder mehr”, sagt Calandra und schweigt kurz. Es war eine Freiheit ohne Werkzeuge zum Leben. Sie und viele andere wussten nicht, wie man Geld verdienen soll, wo man leben soll und wie sich mit anderen verständigen. Von diesem Moment an engagierte sie sich für die Rechte von gefangenen Frauen. Im Jahr 2018 lernte sie Ruiz kennen, sie begannen gemeinsam zu arbeiten.
Für Calandra besteht ein Unterschied zur Arbeit von Ruiz: „Die Männer sagen immer: Die richtige Arbeit würde ein Leben in Würde ermöglichen. Aber so einfach ist es nicht.” Für Frauen sei Lohnarbeit nicht alles. Es gehe häufig um intrafamiliäre Gewalt oder Probleme beim Hüten der Kinder. Wie kann man alles unter einen Hut bringen?
Eigentlich sollte der Staat hier einspringen, doch das macht er nicht. Calandra sagt, dies sein ein Grundproblem: „Dort, wo der Staat fehlt, springen Drogenbanden ein, und der Kreis der Kriminalität schliesst sich.” Denn der Staat sei bei den Armen nur strafend unterwegs: „Die Frau aus dem Armenviertel erscheint im Auge der Staatsgewalt, sobald sie straffällig wird, vorher nicht”, sagt Calandra.
Aus einem mach viele
Ruiz und Calandra erzählen beide, wie wichtig es war, dass sie während ihrer Gefängniszeit Zugang zu Bildung hatten. Es waren Studierende und einzelne gesellschaftlich engagierte Professor*innen, die mit ihnen zu arbeiten begannen. Dort haben sie über ihre Rechte gelernt und erfahren, dass ihre Strafe der Entzug von Freiheit war. Die Gewalt, das Fehlen von Essen sowie andere Schikanen verstossen hingegen gegen ihre Grundrechte.
Heute gibt es im ganzen Land Initiativen, die ihre Erfahrung kopieren. Ruiz und Calandra sind zu Koordinator*innen dieser riesigen Organisation geworden. Sie wächst fast täglich weiter, neue Werkstätten werden eröffnet und bereits bestehende erweitert.
Längst arbeiten sie dabei auch mit staatlichen Behörden zusammen. Einzelne Gemeinden stellen Grundstücke und Lagerhallen zur Verfügung oder kaufen die Produktion auf und stellen damit die Finanzierung sicher.
Ruiz erzählt im Gespräch, dass sie mittlerweile auch mit Gefängnissen zusammenarbeiten und dort erste Genossenschaften gründen: „Es gibt eine grosse Nachfrage, die Gefangenen wollen etwas lernen und arbeiten.” Das erwirtschaftete Geld geht in diesen Fällen direkt an die Familien der Gefangenen.
Mit dieser Initiative werde eine Lücke geschlossen, meint Ruiz: „Wir holen die Gefangenen direkt aus dem Gefängnis ab, bringen ihnen dort einen Job bei und im Moment der Freilassung werden sie von einer Genossenschaft ausserhalb des Gefängnisses übernommen.” Dadurch gebe es weniger Gefahr, dass bei Wiedererlangung der Freiheit alte Muster wiederholt werden.
Dass Ziel der Organisation ist ein Gesetz, dass die Resozialisierung, so wie sie die Genossenschaftler*innen umsetzen, formalisiert und auf Landesebene bei der Umsetzung unterstützt. Auch wenn die Genossenschaften und die Organisation aus der Not geboren sind, sind sich die Aktivist*innen einig, dass sie es besser machen, als der Staat es machen könnte. Daher soll dieser die Aufgaben nicht übernehmen, sondern unterstützend wirken.
Dass, so meint Calandra, wäre ein Paradebeispiel für ganz Lateinamerika. Vor Kurzem war sie in Kolumbien und stellte ihre Arbeit dort vor. Sie meint: „Die Genoss*innen waren fasziniert, denn so etwas gibt es dort nicht.”
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?