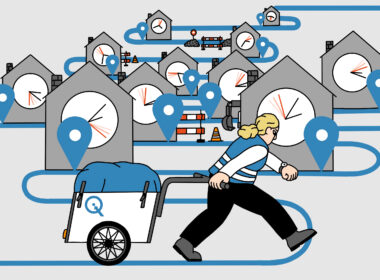Um halb 9 Uhr an einem Mittwochmorgen im Februar ist die Anzahl Personen vor dem British Museum, einem der bekanntesten Museen Londons, noch bescheiden. An einem Baumstamm vor dem Haupteingang hängt ein oranges Banner mit der Aufschrift „On Strike” und ein paar Leute, die sich Leuchtwesten über ihre Winterjacken gestreift haben, stehen auf dem Gehweg und unterhalten sich. Sie alle sind gewerkschaftlich organisierte Mitarbeitende des Museums, die den Anfang eines Streikpostens bilden.
In diesen sogenannten Picket Lines versammeln sich Angestellte, die ihre Arbeit niedergelegt haben, um Passant*innen auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen und Kolleg*innen dazu zu bringen, sich ihnen anzuschliessen. „Die meisten kommen erst später”, sagt Noemi Pettinato, eine der streikenden Museumsmitarbeiter*innen fast entschuldigend. Tags zuvor sei es auch so gewesen. Grund dafür sei der Umstand, dass das Ticket für den Zug, mit dem sie von ihrem Wohnort ausserhalb Londons ins Zentrum fährt, zu Randzeiten rund 10 Pfund weniger koste.
Bilder von Picket Lines und von tausenden Menschen mit Transparenten, auf denen Slogans wie „Enough is Enough“ stehen oder auf denen höhere Löhne – das Hauptanliegen der Streiks – gefordert werden, gingen in den vergangenen Monaten um die Welt.
Am Anfang der aktuellen Streikwelle stand eine Aktion im Juni 2022, bei der um die 40’000 Bahnarbeiter*innen ihre Arbeit niederlegten. Seither haben sich immer mehr Angestellte den Streiks angeschlossen, darunter etwa Lehrer*innen sowie Angestellte des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS).
Wie das britische Statistikamt vor Kurzem bekannt gab, wurden im Jahr 2022 allein knapp 2.5 Millionen Arbeitstage gestreikt, so viel wie seit dem Jahr 1989 nicht mehr. Und das war noch längst nicht alles: Im neuen Jahr gingen die Proteste weiter. So streikten am 1. Februar 2023 500’000 Personen verschiedener Branchen und in den nächsten Wochen sind weitere nationale und regionale Streiks angekündigt.
Im Gegensatz zum 1. Februar, an dem das British Museum geschlossen blieb, arbeiteten zu Beginn dieser Woche genügend Leute, um einen Teil des Museums öffnen zu können. Soeben geht ein junger Mann mit gesenktem Kopf an der Picket Line vorbei und läuft durch das Tor Richtung Gebäude. „Er ist doch auch in der Gewerkschaft, oder?”, fragt ein Kollege Noemi Pettinato mit verärgertem Gesicht. „Ja”, meint sie und zuckt mit den Schultern. Zwischen Streikenden und Streikbrecher*innen, von denen einige am Eingang stehen, deren Schicht bereits begonnen hat, herrscht ein eher entspannter Umgang.
Wie die meisten anderen Streikenden in Grossbritannien fordern auch Pettinato und ihre Kolleg*innen mehr Lohn. Bei der höchsten Inflationsrate seit über 40 Jahren, ganze elf Prozent im vergangenen Jahr, und astronomischen Energiepreisen ist das wenig überraschend. Viele Angestellte, die seit Jahren beim Museum angestellt seien, hätten in Bezug auf die Kaufkraft heute sogar einen tieferen Lohn als zu Beginn ihrer Anstellung, da sie über Jahre hinweg nicht den vollen Teuerungsausgleich erhielten, sagt Pettinato, die im Besucher*innenzentrum des Museums arbeitet.
Wenig ist es sowieso: „Nach den Steuerabzügen bleiben mir etwa 1’500 Pfund”, also rund 1’650 Schweizer Franken. Als Alleinstehende zahle man in London für ein einzelnes Zimmer bis zu 1’000 Pfund Miete. Das bezieht sich wohlgemerkt auf die Miete für ein einzelnes, preiswertes Zimmer. „Dazu kommen 200 Pfund für den Transport. Und wenn du noch was essen oder sonst leben willst, kannst du dir selbst ausrechnen, wie viel dir dafür noch bleibt.” Für Pettinato ist es das erste Mal, dass sie für ihre Rechte als Arbeitnehmerin kämpft. „Es fühlt sich gut an”, meint sie lächelnd. „So, als wären wir auf der richtigen Seite.”
An den Hochschulen wird schon lange gestreikt
Genau wie Pettinato streiken viele Brit*innen zum ersten Mal in ihrem Leben – und das nicht nur in London, sondern in allen Landesteilen. Andere sind da geübter, namentlich die Uni-Angestellten, die seit über zehn Jahren regelmässig ihre Arbeit nieder- und den Hochschulbetrieb teilweise lahmlegen. In der Woche vor dem Museumsstreik hatten Mitglieder der University and College Union (UCU), einer Gewerkschaft von Uniangestellten, an verschiedenen Hochschulen im Land gestreikt, unter anderem im schottischen Glasgow.
Es regnet ausnahmsweise gerade nicht, als sich UCU-Mitglieder am Freitagmittag auf den Buchanansteps im Zentrum Glasgows versammeln. Einige Leuchtwesten, ein paar Transparente und viele pinke Strickmützen mit dem Logo der Gewerkschaft sind zu sehen. Um kurz vor 1 Uhr haben sich etwa 40 Leute vor den Buchanan Steps in der Fussgänger*innenzone versammelt, als plötzlich aus der Ferne Trillerpfeifen zu hören sind. Eine Mini-Demo bestehend aus Studierenden, die den Streik der Angestellten unterstützen, stösst dazu.
Als die Vertreter*innen der Gewerkschaft sowie des STUC, eines Dachverbandes von Gewerkschaften in Schottland, auf der Treppe ihre Reden halten, sind knapp 100 Personen versammelt. Die Stimmung ist trotz der eisigen Bise und des ernsten Themas gut, es wird ausgiebig geklatscht, ein paar ältere Männer halten ab und zu die zur Faust geballte Hand in die Luft. Die Redner*innen beziehen sich nicht nur auf die eigenen prekären Bedingungen an der Uni, sondern verorten sich in einem gesamt-britischen Kampf für Arbeiter*innenrechte.
„Das ist der dritte Streiktag in diesem Jahr, weitere 15 Tage sind geplant“, sagt Catriona Mowat, eine der Redner*innen, nachdem der offizielle Teil der Veranstaltung vorbei ist. Mowat arbeitet in der Univerwaltung und ist Teil der UCU Glasgow Caledonian University. Die Angestellten der Unis, darunter viele Lehrkräfte, fordern seit Jahren höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und keine Rentenkürzungen – bisher erfolglos.
Doch dieses Mal könnte es anders kommen. „Es fühlt sich jedenfalls anders an”, sagt Mowat und meint damit die Streikwelle, die ganz Grossbritannien erfasst hat und auf viel Sympathie stösst. „Der ganze öffentliche Sektor ist am Streiken und wir erhalten sehr viel Unterstützung aus der Bevölkerung”, sagt Mowat.
Innerhalb ihrer Uni streiken nicht nur Lehrkräfte und Büroangestellte, sondern aktuell auch Teile des Putzpersonals – mit denen man sich solidarisiere. Und von den Studierenden habe man noch nie so viel Zuspruch erhalten. Tatsächlich sind diese teilweise von den Streiks an ihren Unis genervt, was vor allem mit den horrenden Studiengebühren von je nach Studiengang und Hochschule um die 10’000 Pfund pro Semester zu tun hat. Doch aktuell scheinen viele Verständnis für die Anliegen ihrer Dozent*innen zu haben und sehen die Schuld für die Streiks eher bei den Universitätsleitungen.
Sie habe Hoffnung, dass sich etwas bewege, meint Catriona Mowat. Vor Kurzem habe ihnen die Unileitung ein Angebot für eine Lohnerhöhung gemacht – allerdings kein befriedigendes: Ihre Mitglieder hätten das Angebot in einer Online-Abstimmung abgelehnt.
Wenige Tage nach dem Streiktag in Glasgow fanden weitere Verhandlungen statt. Mowat glaubt, dass auch die aktuelle Politik der Tory-Regierung die Streiks zusätzlich befeuere. „Gerade das neue Anti-Streik-Gesetz trägt viel dazu bei, dass die Leute einfach wütend sind.” Mowat meint die „Strikes (Minimum Service) Bill”, der Entwurf eines neuen Gesetzes, mit dem festgelegt werden soll, dass gewisse, als systemrelevant definierte Berufe ein Minimum an Dienstleistungen sicherstellen müssten.
Konkret bedeutet das: Einer bestimmten Anzahl Personen, beispielsweise der Belegschaft einer Krankenhausabteilung, könnte es verboten werden, zu streiken – sie wären gesetzlich zur Arbeit gezwungen. Das Gesetz wird derzeit gerade im House of Lords behandelt und hat in breiten Schichten der Bevölkerung Protest ausgelöst. Es wäre nur das neueste in einer ganzen Reihe von Gesetzen, welche das Recht zu streiken in Grossbritannien einschränken oder erschweren.
Die Prekarität des Lebens analysieren
Die aktuelle Streikwelle nicht nur zu beschreiben und zu feiern, sondern sie auch zu hinterfragen und zu analysieren, ist etwas, das sich die Angry Workers zur Aufgabe gemacht haben. Das seit 2014 bestehende Kollektiv hat auf seiner Website Texte publiziert, in denen es die Arbeitskämpfe der vergangenen Monate einordnet.
Gegründet wurde das Kollektiv ursprünglich von einer Handvoll Leuten, die beschlossen, sich in einem Viertel Londons niederzulassen, in dem vorwiegend migrantische Arbeiter*innen wohnen. Dort nahmen sie schlecht bezahlte Jobs in Produktion und Logistik an und begannen, Netzwerke aufzubauen, eine eigene Zeitung unter die Leute zu bringen und ihre Kolleg*innen bei den Kämpfen für ihre Rechte zu unterstützen.
Mittlerweile ist das Kollektiv gewachsen und besteht nicht mehr ausschliesslich aus Personen, die ihr Berufsleben ganz der politischen Arbeit widmen. Seit Beginn dabei ist Peter*. Er sitzt ein paar Tage nach dem Streik der Museumsmitarbeitenden in seiner Küche in einem Haus in der englischen Stadt Bristol, wo er seit zwei Jahren lebt. „Gestern hatte ich eine Zwölfstunden-Schicht im Spital, dann bin ich mit dem Fahrrad noch in den Ast eines Baumes gefahren”, erklärt er und deutet auf einen Kratzer auf seiner Stirn. Nach dreissig Jahren in Industriebetrieben hat Peter zum ersten Mal einen Job als Pflegeassistent. Der Job sei hart, die Schichten zu lang, aber er habe schon einiges für sich gelernt, meint er nüchtern.
Als Mitarbeitende des nationalen Gesundheitsdienstes vor Kurzem streikten – je nach Sektor und Gewerkschaft zum ersten Mal seit dreissig Jahren oder gar zum ersten Mal überhaupt – war auch Peter dabei. „Die Beteiligung meiner Abteilung an den Picket Lines war leider sehr bescheiden”, sagt er. „Von denjenigen, die kamen und sich solidarisiert haben, hätten die meisten eigentlich frei gehabt und waren also gar nicht am Streiken.”
Peter glaubt, dass es auch an der mangelnden Vorbereitung und Unterstützung der Gewerkschaften lag, dass in seinem Spital nicht mehr Leute streikten. „Ich habe bei meiner Gewerkschaft eingebracht, dass es Sinn machen würde, sich mit anderen zu koordinieren, aber niemand wollte auf mich hören.” Den traditionellen Gewerkschaften gegenüber sind die Angry Workers sowieso sehr kritisch und bemängeln unter anderem, die Funktionär*innen kümmerten sich mehr um die eigene Profilierung als um die Interessen der Arbeiter*innen oder seien zu reinen Dienstleistungsanbietern verkommen.
Dank der Streiks erleben aktuell viele der traditionellen Gewerkschaften in Grossbritannien einen extremen Zuwachs. So verzeichnete etwa die grösste britische Bildungsgewerkschaft (NEU), in der unter anderem Lehrer*innen organisiert sind, nach der Ankündigung des Streiks in nur zwei Wochen über 30’000 neue Mitglieder.
Trotz der Kritik an den Gewerkschaften solidarisieren sich die Angry Workers mit allen streikenden Arbeiter*innen. Was von den Streiks bleiben wird und wohin sie sich entwickeln? Peter mag keine Prognose abgeben. „Zumindest lernen gerade viele Leute, wie sich Verhältnisse zwischen Kolleg*innen während eines Streiks verändern, wie Unternehmensleitungen und die Regierung darauf reagieren und wie frustrierend die Gewerkschaftsbürokratie sein kann.“
*Peters Name wurde auf seinen Wunsch hin geändert.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?