„Familien ziehen von einer temporären Wohnung zur nächsten, leben in bedrängten Verhältnissen. Ältere Menschen ziehen verfrüht in Altersheime, Kinder müssen mehrfach die Schule wechseln”, schildert ein Mitglied des Zürcher Kollektivs Mietenmarta die dramatischen Folgen der Wohnungsnot in der Schweiz. „Einbürgerungsverfahren werden unterbrochen, gewachsene Nachbarschaften zerbrechen – und mit ihnen jahrzehntelang aufgebaute Unterstützungsnetzwerke.” Das Kollektiv beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Wohnkrise sowie sozialer Verdrängung und betreibt einen Rechercheblog zum Thema.
Die Zahlen sprechen für sich: Der Wohnungsleerstand in der Schweiz ist historisch niedrig – besonders drastisch in Zürich. Im Juni 2024 waren lediglich 169 Wohnungen unbewohnt, das entspricht einer Leerwohnungsziffer von nur etwa 0.07 Prozent. Zudem sind die meisten davon hochpreisige, sanierte Neubauten mit entsprechend hohen Mieten. Während der Leerstand sinkt, steigen die Mieten rasant: Zwischen 2000 und 2022 erhöhten sich die durchschnittlichen Mietpreise im Kanton Zürich um rund 40 Prozent, Tendenz weiter steigend.
Die Schweiz gilt international als Extrembeispiel für explodierende Mieten und soziale Verdrängung.
Die Schweiz gilt international als Extrembeispiel für explodierende Mieten und soziale Verdrängung. Der wachsende Druck führt immer häufiger zu existenziellen Notlagen. Was früher vor allem marginalisierte Gruppen traf, erreicht heute zunehmend auch den Mittelstand. Besonders stark und anhaltend belastet bleiben jedoch Geflüchtete, prekär Beschäftigte und Menschen ohne gesichertes Einkommen. Die Zahl der Wohnungslosen nimmt kontinuierlich zu, während politische Entlastungen bislang ausbleiben.
Gerade deshalb engagieren sich staatsunabhängige Initiativen wie Mietenmarta für ein grundlegendes Umdenken in der Wohnpolitik. Ihr Ziel: menschenwürdiger Wohnraum für alle.
Das grundlegende Problem
Die Nachfrage nach Wohnraum wächst in der Schweiz stetig. Obwohl in vielen Städten gebaut wird, sind die teuren Neubauten für die meisten unerschwinglich. Ein Hauptgrund für den Wohnungsmangel sind unnötige Ersatzneubauten: der Abriss günstiger Mietwohnungen zugunsten neuer, meist grösserer und teurerer Einheiten.
„Zürich ist Ersatzneubau-Königin”, sagt das Kollektiv Mietenmarta. „Bezahlbarer Wohnraum wird abgerissen, grössere und teurere Wohnungen entstehen – die bisherigen Mieter*innen werden verdrängt.”
Hinzu kommt: In der Schweiz gibt es zwar eine gesetzliche Grenze dafür, wie viel Rendite Vermieter*innen mit Mietwohnungen erzielen dürfen – den sogenannten Renditedeckel. Er soll sicherstellen, dass sich Mieten an den effektiven Kosten orientieren, nicht am Maximalgewinn. Laut Bundesgericht liegt dieser Deckel aktuell bei rund 3.5 Prozent.
Doch kontrolliert wird das kaum: Es fehlen staatliche Stellen, die systematisch prüfen, ob sich Vermieter*innen an den Renditedeckel halten. Verstösse bleiben oft folgenlos – es sei denn, einzelne Mieter*innen wehren sich aktiv. Ein Aufwand, den viele nicht leisten können oder wollen. Genau hier setzt die aktuelle Miet-Initiative von SP und Mieterverband an: Sie fordert regelmässige Kontrollen und will so sicherstellen, dass die gesetzlichen Obergrenzen auch tatsächlich eingehalten werden. Momentan läuft die Unterschriftensammlung.
Wer heute investiert, kauft Boden nicht für Wohnzwecke, sondern als Anlageobjekt.
Ohne Kontrollen bleibt die Schweiz vorerst ein Paradies für Wohnraumspekulation. Denn längst wird nicht nur mit Wohnungen spekuliert, sondern mit dem Boden selbst – einem Gut, das knapp und zunehmend privatisiert ist. Wer heute investiert, kauft Boden nicht für Wohnzwecke, sondern als Anlageobjekt. Das Angebot bleibt künstlich knapp, die Preise steigen. Demzufolge soll aus gentrifizierten Objekten ein Maximum an Profit herausgeschlagen werden. Ganz nach dem Motto: aufkaufen, sanieren, teuer vermieten.
Währenddessen steigt der finanzielle Druck für weite Teile der Bevölkerung kontinuierlich. Eine 3‑Zimmer-Wohnung kostet in Zürich inzwischen etwa 2’800 Franken. Mit Lebenshaltungskosten summieren sich die Fixausgaben auf etwa 4’200 Franken im Monat – bei Löhnen von teils nur 3’500 bis 4’000 Franken im Tieflohnsektor. Besonders betroffen von diesen prekären Einkommen sind Frauen. Im Jahr 2020 machten sie rund zwei Drittel des Tieflohnsektors aus.
Der Tieflohnsektor bezeichnet Jobs, in denen das Einkommen unter einer bestimmten Schwelle liegt – meist definiert als zwei Drittel des Medianlohns. In der Schweiz lag diese Schwelle (je nach Jahr) zum Beispiel bei rund 4’300 Franken brutto im Monat. Betroffen sind vor allem Berufe im Detailhandel, in der Pflege, Reinigung oder Gastronomie – oft schlecht bezahlt, trotz hoher Arbeitsbelastung.
Diese Entwicklung spiegelt sich nicht nur in den Statistiken wider, sondern auch in der subjektiven Wahrnehmung breiter Bevölkerungsschichten. Auch bei jungen Menschen: In einer repräsentativen Umfrage des Wirtschaftsunternehmens Deloitte lösten die steigenden Lebenshaltungskosten 2024 den Klimawandel als grösste Sorge der Gen Z ab.
Politische Vorstösse scheitern bisher
Zur Entschärfung der Wohnungsnot setzt die schweizerische Politik seit Langem auf genossenschaftlichen Wohnungsbau. Besonders Zürich gilt als Erfolgsmodell. „Preisgünstiger Wohnraum soll effektiv gefördert werden”, betonte der zuständige Regierungsrat im vergangenen Juli. Tatsächlich gehört der Kanton zu den Vorreitern in Sachen genossenschaftlicher Wohnungsbau: Im Jahr 2023 waren in Zürich bereits 27 Prozent der Wohnungen gemeinnützig. Zum Vergleich: Landesweit gehören Stand 2025 lediglich 4 Prozent der Wohnungen den Genossenschaften. Das sind gerade einmal 185’000 Wohneinheiten.
In Zürich halten die Grossbanken Credit Suisse und UBS zusammen rund 70’000 Wohneinheiten.
Ein kantonales Vorverkaufsrecht, das den Erwerb von Liegenschaften vor privaten Investoren ermöglicht hätte, wurde dennoch abgelehnt. Der Regierungsrat des Kantons begründete dies mit der „Wahrung der Wirtschaftsfreiheit” – trotz entsprechender Forderung der Volksinitiative „Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich”. Auch die „Wohnschutz Initiative“, die unter anderem gegen drastische Mieterhöhungen bei der Sanierung von Liegenschaften vorgeht, wurde vom Regierungsrat in der Vergangenheit bereits abgelehnt. Der Vorwurf: Die Mietpreisbegrenzungen würden dazu führen, dass das verdichtete Bauen weniger attraktiv werden würde, so die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh (FDP).
Wohin das führt, zeigt sich auf dem Zürcher Wohnungsmarkt eindeutig: Die „Institutionellen”, also beispielsweise Grosskonzerne, Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassen können durch breite Marktanteile Preise künstlich in die Höhe treiben. Dazu zählt auch die Pensionskasse des Kantons Zürich (BVK), der laut eigenen Angaben über 6’000 Wohneinheiten im Kanton gehören. Ein Grossteil von ihnen sind kleinere, teuer sanierte Apartments, die hochpreisig vermietet werden können.
„Die Regierung muss mehr Verantwortung übernehmen”, sagt Mietenmarta. In jüngerer Zeit zeigt sich zwar immer deutlicher, dass vor allem die SP und die Grüne die Profitlogik der Konzerne regulieren wollen. Doch viele Parteien nutzen die prekäre Lage weiterhin, um ihre eigenen politischen Positionen in die Debatte einzubringen. „Die SVP behauptet irrigerweise, eine Beschränkung der Zuwanderung könne die Wohnkrise lösen – und verschweigt gleichzeitig, dass die dadurch allenfalls leer werdenden Wohnungen keinen Rappen günstiger werden würden“, so das Mietenkollektiv.
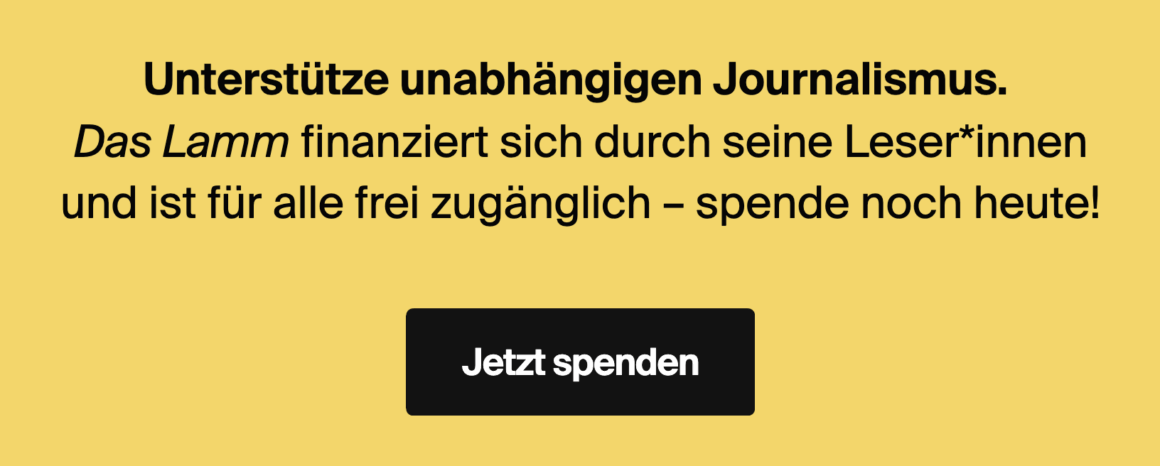
Auch vermeintlich progressive Parteien tun sich schwer, die Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen – nicht zuletzt wegen den strukturellen Problemen des Immobilienmarkts. SP und Grüne setzen sich – auch kommunal – für den Ausbau des gemeinnützigen Wohnungsbaus ein. Immer wieder wird, wie zuletzt durch die SP-Nationalrätin Sarah Wyss im SRF-Format „Arena”, die konsequente Überprüfung des Renditendeckels gefordert.
Dennoch gehen die progressiven Entwicklungen nur zäh voran. In Zürich halten die Grossbanken Credit Suisse und UBS derzeit zusammen rund 70’000 Wohneinheiten. Nach der Fusion ihrer Immobilienportfolios sind sie die grössten privaten Wohnraumbesitzer der Stadt. Diese Marktkonzentration verschafft ihnen beträchtliche wirtschaftliche Spielräume. In der Praxis bedeutet das häufig: noch mehr Ersatzneubauten und Spekulationsraum.
Solidarisch gegen Verdrängung
In Zürich bieten solidarische Strukturen Antworten auf die Wohnkrise. Das Mietenplenum konnte beispielsweise einzelne Häuser retten und wehrt sich gegen Mietzinserhöhungen oder Leerkündigungen. „Dabei konnten bereits einige Erfolge erzielt werden”, betont das Kollektiv Mietenmarta. Für Mietenmarta sind auch Initiativen wie das Vorkaufsrecht („Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich”), das langjährige Engagement gegen Airbnb und vor allem die kantonale Wohnschutz-Initiative ein erster Anfang, auf dem es jetzt aufzubauen gilt. „Eine Chance sehen wir auch darin, dass sich Gewerkschaften stärker im Wohnthema engagieren.”
Das Mietenplenum ist ein loses Bündnis, das in Zürich und Bern agiert und gegen die Wohnkrise, steigende Mieten und soziale Verdrängung Menschen zusammenbringt. Im Fokus stehen neben Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit auch die Hilfe von betroffenen Personen, beispielsweise bei Kündigungen oder gestiegenen Nebenkosten.
Ein weiterer wichtiger Akteur gegen die bedrückende Lage auf dem Wohnungsmarkt ist das Internetcafé Kafi Klick in Albisrieden. „Wir sind ein Treffpunkt und ein Ort des Austausches”, erklärt eine Mitarbeiterin. „Ausserdem bieten wir vielfältige Beratungen an – etwa zur Job- und Wohnungssuche oder im Kontakt mit dem Migrationsamt.” Besonders Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, würden die Angebote zunehmend nutzen.
Wie lässt sich eine Gesellschaft lebenswert gestalten, in der Profite über den grundlegenden Bedürfnissen wie Wohnen stehen?
In Zeiten wachsender sozialer Unsicherheit sei solidarisches Handeln wichtiger denn je. Das Kafi Klick unterstützt Wohnungssuchende unter anderem beim Verfassen von Bewerbungen, beim Zusammenstellen vollständiger Unterlagen und beim Erwerb digitaler Kompetenzen. „Die aktive Begleitung bei der Wohnungssuche übersteigt jedoch leider unsere Kapazitäten.”
Darüber hinaus versteht sich das Kafi Klick als sozialer Raum, in dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen. „Wir möchten zeigen, dass niemand mit diesen Herausforderungen allein ist”, so die Mitarbeiterin. Der Austausch helfe, der Vereinzelung entgegenzuwirken – denn das eigentliche Problem sei strukturell.
Mögliche Verbesserungen
Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt: Der Wohnungsmangel ist kein rein schweizerisches Problem. In mehreren Städten ausserhalb der Schweiz haben Parteien niederschwellige Beratungsangebote für Mieter*innen eingerichtet. In der Steiermark, Österreich, etwa führte die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) bereits in den 1990er-Jahren den sogenannten Mieternotruf ein – eine rund um die Uhr erreichbare Hotline, über die Mietverträge geprüft oder Fragen zu Provisionen geklärt werden können. Die kontinuierliche Mietberatung war mitentscheidend für den Wahlerfolg der KPÖ in Graz.
Auch in Deutschland wird parteiliche Mietarbeit zunehmend als Teil linker Basisarbeit verstanden. In Berlin bietet Niklas Schenker, Abgeordneter der Linkspartei, regelmässig Wohn- und Sozialsprechstunden an. „Zu mir kommen Menschen, die beispielsweise eine Mieterhöhung, Kündigung oder Heizkostenabrechnung erhalten oder andere Probleme mit ihrem Vermieter haben”, erklärt er. Viele bekämen bei Ämtern oder offiziellen Stellen keine ausreichende Unterstützung. Das Angebot richte sich daher gezielt an jene, die besonders dringend Hilfe brauchten.
Solche niederschwelligen Angebote könnten auch in der Schweiz einen politischen Zugang zum Wohnproblem eröffnen. Zumindest um Missstände zu adressieren und parlamentarische Impulse zu setzen. In Berlin hatten vergleichbare Initiativen konkrete Folgen: So wurde in der vergangenen Legislaturperiode ein Mietendeckel beschlossen, der die Wohnkosten kurzzeitig regulierte, bevor er von konservativen Kräften im Abgeordnetenhaus wieder gekippt wurde.
Dieses Beispiel zeigt die Grenzen parlamentarischer Einflussnahme: Die Situation auf dem Schweizer Wohnungsmarkt verweist letztlich auf eine tiefere Systemfrage. Wie lässt sich eine Gesellschaft lebenswert gestalten, in der Profite über den grundlegenden Bedürfnissen wie Wohnen stehen? Wenn Wohnraum nicht als Grundrecht verstanden wird, drohen politische Prozesse – gleich welcher Couleur – ins Leere zu laufen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?














