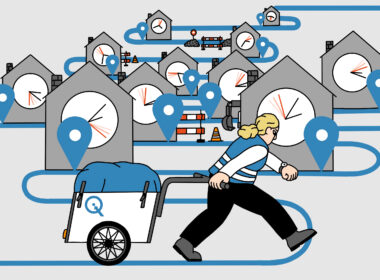Eines vorweg: es gibt in der Schweiz keine gesetzliche Definition des öffentlichen Raumes. Doch es besteht ein scheinbar übergreifendes Grundsatzverständnis. Der öffentliche Raum grenzt sich in erster Linie vom privaten Raum ab, heisst also: von dem Raum, der nicht der öffentlichen Hand gehört. Zudem unterscheidet er sich von Räumlichkeiten der öffentlichen Hand, die eine explizite Aufenthaltsbewilligung verlangen. Darunter fallen etwa Militäreinrichtungen oder Spitäler. Was übrig bleibt, sind Seepromenaden, Stadtparks und Bahnhofsplätze, die sich gerade im Sommer grosser Beliebtheit erfreuen.
Der demokratiefördernde Charakter des öffentlichen Raumes
In einer Zeit, in der sogenannte „Bubble-Bildungen“ in den Sozialen Medien eine immer grössere Herausforderung für die Demokratie darzustellen scheinen, erhält der öffentliche Raum neue Bedeutung. Während man online unliebsame Lebenswelten und Weltanschauungen mit wenigen Klicks rausfiltern kann, ist man beim Gang durch den Bahnhof gezwungen, sich diesen zu stellen. Unterschiedliche Meinungen sind die Grundlage für politischen Diskurs, die Konfrontation mit dem Unbekannten und Befremdlichen sein Antrieb.
Gerade aber diese Konfrontation ist in Gefahr. Die weltweite politische Polarisierung wird immer öfters in Zusammenhang mit der „Bubble-Bildung“ in den Sozialen Medien gebracht. Zwar ist dieser Zusammenhang umstritten. Doch niemand bezweifelt, dass die Verlagerung des politischen Diskurses von der Stammtisch- und Landsgemeinde auf Facebook und Twitter eine tiefgreifende Veränderung bedeutet.
Genau in dieser Situation könnte der öffentliche Raum Abhilfe schaffen. Es ist unrealistisch (und auch nicht wünschenswert), den politischen Diskurs vollständig zu seinen analogen Ursprüngen zurückzuführen. Aber dadurch, dass die NutzerInnen des öffentlichen Raumes keine Filter anwenden können, kommt ihm neue Bedeutung zu: nämlich als Ort, wo die unterschiedlichsten Lebenswege und Weltanschauungen kollidieren können.
Wobei: Neu ist diese Bedeutung nicht. Wie der Architekt Christoph Haerle sagt, beginnt die Geschichte des öffentlichen Raumes bei den alten Griechen. Dort wurden Freiräume geschaffen, umrahmt von staatlichen Institutionen, Bildungsanstalten, Handelsgebäuden und Kulturpalästen. Der symbolische Charakter ist offensichtlich: Die grossen Elemente einer zivilisierten Gesellschaft bilden einen Raum, in welchem Begegnungen ermöglicht und provoziert werden.
Es ist wohl kein Zufall, dass der öffentliche Raum, wie wir ihn heute verstehen, seinen Ursprung in der Wiege der Demokratie hat. So merkt Haerle im zweiten Teil des sehr empfehlenswerten Gesprächs mit der Plattform Geschichte der Gegenwart an, dass „[ö]ffentlicher Raum [dann] glückt, wenn dieses Aushandeln so passiert, dass alle Beteiligten zugunsten eines Gesamtinteressens einen Schritt von ihrem Eigeninteresse zurücktreten.” Die demokratische Grundmaxime also.
Ein bisschen Mittelalter in der Moderne
In der Realität ist die Diskussion um öffentliche Räume aber seit je her geprägt von Nutzungskonflikten. Im Mittelalter galt die Wegweisung aus dem Stadtstaat als gängige Strafe, in Istanbul gingen die Menschen 2013 gegen den Bau eines Einkaufszentrums auf dem Gebiet des Gezi-Parks auf die Strasse. Erstere Methode erlebt in der Schweiz seit 1997 ein Revival. Damals wurde mit der Einführung der Lex Wasserfallen in Bern zum ersten Mal ein sogenannter Wegweisungsartikel in ein kantonales Polizeigesetz geschrieben. Dieser erlaubt es der Polizei, eine Person mit einem Rayonverbot zu belegen, wenn „der begründete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansammlung zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören”. Der damalige Polizeidirektor Kurt Wasserfallen wollte mit dem neuen Polizeigesetz eine Möglichkeit schaffen, die offene Drogenszene rund um den Bahnhof zu bekämpfen.
Doch früh war auch klar, dass die offene Formulierung des Artikels dafür verwendet werden kann, alle unliebsamen Personen und Ansammlungen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. „Ursprünglich war die Lex Wasserfallen dazu gedacht, störende Menschen aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben”, ist Ruedi Löffel, langjähriger Gassenarbeiter beim Verein Kirchliche Gassenarbeit Bern, überzeugt. Der Hintergedanke: Menschenansammlungen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, schaden dem Stadtbild.
Der Verein Kirchliche Gassenarbeit Bern gehörte zu den ersten Stimmen, die sich gegen die Einführung und Umsetzung des Artikels einsetzten. Er unterstützte die Betroffenen auch bei der Formulierung von Beschwerden. „Am Anfang gab es viele Einsprachen, einige wurden sogar gewonnen. Aber da die Einsprachen auf die Wegweisung keine aufschiebende Wirkung haben, hatten sie keinen unmittelbaren Effekt”, erinnert sich der Gassenarbeiter. Trotz des vehementen Widerstandes gegen die Praxis erwies sich der Wegweisungsartikel als Exportschlager für Bern: Heute steht er in der einen oder anderen Form in 18 kantonalen Polizeigesetzen.
Stadtaufwertung mittels Wegweisungen
Und so seien Wegweisungen mittlerweile ein „anerkanntes Instrument der Polizeiarbeit”, wie der Sicherheitsdirektor von Bern, Reto Nause, unlängst feststellte. Ein Mittel mit dem man dem Wunsch aus der Bevölkerung nach mehr Sicherheit nachkomme. Doch gerade hier widerspricht Löffel: “Den Sicherheitsaspekt bei den Wegweisungen, mit welchen wir zu tun haben, sehe ich nicht.” Die meisten Wegweisungen, mit denen der Verein Kirchliche Gassenarbeit Bern zu tun habe, fänden in Stadtgebieten statt, die vor allem durch Kundschaft und TouristInnen frequentiert sind. „Aus meiner Sicht ist es ein Instrument dafür, das Stadtbild sauber zu halten.” Oder, um es in einem einprägsamen Scheinanglizismus auszudrücken: Die Wegweisungen dienen der „City-Pflege“.
Durch die Wegweisung von Menschen, die den gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen, kann der öffentliche Raum aufgewertet werden, so die Theorie hinter der „City-Pflege“. Und wenn man sich die Sprache von PolitikerInnen anschaut, die sich für Wegweisungen einsetzten, dann erhärtet sich der Eindruck, dass zumindest implizit der Wunsch nach einem ästhetischen Stadtbild mitschwingt. Da verkommt der Bahnhof Basel schnell mal zur Beiz für Randständige, die Flusspromenade von Olten zur schlechten Visitenkarte für die Stadt, das alte Bahnhofsportal in Luzern wird zu einem Schandfleck.
„Bubble-Bildung” im öffentlichen Raum
Hier offenbart sich der Nutzungskonflikt. Für die einen nehmen sogenannte „Randständige” den öffentlichen Raum in die Mangel; für die anderen bilden die Wegweisungen einen unrechtmässigen Eingriff in ihre Bewegungsfreiheit. „Bei Wegweisungen entsteht bei den Betroffenen nicht das Gefühl, etwas Falsches getan zu haben. Sie halten sich in ihrem Wohnzimmer, der Gasse, auf und verstehen nicht, wieso sie stören”, sagt Ruedi Löffel. „Wenn sich meine Freunde irgendwo treffen, dann gehe ich doch wieder dorthin. Da nehme ich die Busse halt in Kauf.”
Dabei sei nach dieser langen Zeit auch eine Resignation zu spüren. So gibt es Personen, die schon mehr als 100 Wegweisungen erhalten habe. Das führt laut Löffel zu einem Teufelskreis: Da viele Betroffene kein Geld hätten, um die entsprechenden Bussen zu zahlen, würden sie ins Gefängnis gehen, um diese abzusitzen. Das sei nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch aus finanzpolitischer Sicht völlig unsinnig: Laut Löffel sitzt man pro Tag 100 Franken Busse ab, während ein Tag im Gefängnis den Staat laut Schätzungen 400.- kostet.
Und nicht minder bedenklich als der moralische und finanzielle Aspekt der Praxis: Die Wegweisung als Instrument der „City-Pflege“ funktioniert als Filter im öffentlichen Raum. Motiviert durch eine Ästhetisierung des Stadtbildes werden gewisse Personengruppen systematisch aus dem öffentlichen Raum ferngehalten. Dadurch entfällt nicht nur die Repräsentation dieser Lebenswelten in der öffentlichen Debatte, sondern es wird auch eine Sensibilisierung für die Probleme einer Gesellschaftsschicht verhindert. Oder wie es der Zürcher Staatsrechtler Daniel Moeckli ausdrückt: „Je mehr man die Leute vor Andersartigkeit schützt, desto ängstlicher werden sie, desto mehr rufen sie nach strengeren Gesetzen.”
Der öffentliche Raum muss nach der demokratischen Grundmaxime gestaltet sein. Ist dies zum Beispiel aufgrund von Rayonverboten nicht der Fall, wird produktive Konfrontation verhindert, der politische Diskurs unterbunden. Wer sich vor einer Bubble-Bildung in den Social Media fürchtet, der sollte mindestens genauso viele Sorgen um ein Stadtbild haben, das einen sowieso schon unterrepräsentierten Teil der Gesellschaft ausschliesst.
Einige, wie zum Beispiel Daniel Moeckli, sehen durch die Wegweisungen den Rechtsstaat in Gefahr. Für die Menschen, mit denen der Verein Kirchliche Gassenarbeit Bern zu tun hat, bedroht die Praxis ihren Lebensmittelpunkt, ihr Wohnzimmer — und im Endeffekt ihre Freiheit.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!