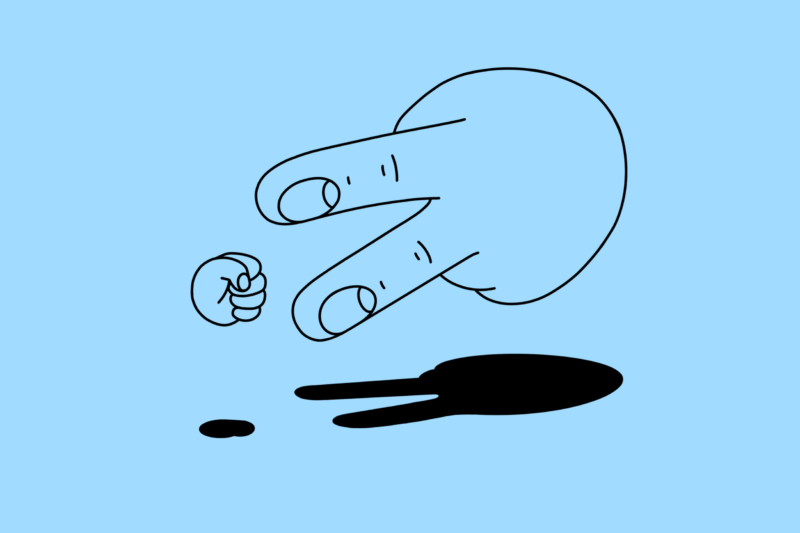Zwei Sachen fallen bei der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von Ende 2022 auf. Zunächst das Erwartbare: Die obersten zehn Prozent sind für 37 Prozent des gesamten Spendenaufkommens verantwortlich. Aber dann: „Relativ zum verfügbaren Einkommen spenden einkommensschwache Haushalte deutlich mehr als einkommensstarke.“ Arme Menschen spenden im Durchschnitt 1.9 Prozent ihres Einkommens, die obersten zehn Prozent dagegen nur 0.9 Prozent.
Eine Erhebung des Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2017 über das Haushaltsbudget der Schweizer*innen ergibt ein ähnliches Bild: Die niedrigste Einkommensklasse hat damals knapp 0.5 Prozent ihres Einkommens gespendet, die höchste Einkommensklasse nur rund 0.3 Prozent. Dass arme Menschen mehr spenden als Reiche, ist ein internationaler Trend. Skandinavische Forscher*innen befragten in einer Studie weltweit 46’000 Personen und fanden heraus, „dass Personen, die in einem ressourcenarmen Umfeld aufgewachsen sind, im Vergleich zu anderen eine stärkere moralische Identität haben. Sie waren eher bereit, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden.“
Menschen, die arm sind, haben eine stärkere moralische Identität. Bäm, da habt ihr den direkten Vergleich, ihr Schnösel, möchte man denjenigen zurufen, deren Sport es ist, arme Menschen zu verunglimpfen. Hat sich die erste Freude über die Erkenntnis gelegt, stellt sich aber die Frage, warum es uns überhaupt so wichtig ist, Beweise für eine tolle Moral der Unterklasse zu liefern?
Das Netzwerk Chancen, eine Initiative, die Arbeiter*innenkindern den Aufstieg erleichtern will, beantwortet die Frage indirekt – indem sie auf Instagram eine Grafik der Studie des DIW posten. Darunter steht: „Was meint Ihr, was das über unsere Gesellschaft sagt?“
Die Geschichte von den guten Armen
Ja, was sagt uns das jetzt? Arme sind die besseren Menschen und Reiche sind geizig? Vielleicht ist es das, was man beim Netzwerk Chancen impliziert hatte. Vielleicht ist die Antwort aber eher, dass Armutsbetroffene darauf angewiesen sind, dass ihnen geholfen wird, und daher selbst öfter helfen. Schlagzeilen wie die von spendenwilligen Armen sind Gegenargumente zu klassistischen Framings und Vorurteilen à la Arme sind faul, sie wählen rechts et cetera. Studien, wie die oben angeführte, helfen, falsche Bilder über Armutsbetroffene ins richtige Licht zu rücken. Das ist erst mal etwas Gutes.
Die Logik, die hinter einer solchen Nachricht steckt, ist allerdings eine moralisierende. Der Subtext: Guck, die sind gut, also müssen wir für sie kämpfen. Wenn arme Menschen sich für andere einsetzen, dann haben sie es verdient, dass man sich ebenfalls für sie einsetzt. Gewiss meinen es viele Menschen – und auch die Leute vom Netzwerk Chancen – nicht böse, wenn sie sich an derartigen Werturteilen beteiligen. Das Ergebnis aber ist dasselbe: Es wird zwischen guten, weil integren, und schlechten Armen unterschieden. Wo nach Gründen gesucht werden muss, warum Menschen Armut nicht verdient haben, da ist die Erkenntnis nicht weit weg, dass manche ihre Armut vielleicht doch verdient haben.
Diesen Twist kennt man aus Migrationsdebatten, wo fein säuberlich zwischen guten, weil fleissigen und gut ausgebildeten Arbeitsmigrant*innen und unrechtmässigen Migrant*innen unterschieden wird. Oder die Unterscheidung zwischen Asylsuchenden und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, die „nur“ arm sind und nicht aus Kriegsgebieten flüchten.
Das Problem bei dieser Logik ist: Es wird immer Gründe geben, warum man sich über Arme erheben kann. Seien es die geringeren Corona-Impfquoten, die geringere Beteiligung an Wahlen oder ihre politische Ausrichtung.
Statt über die moralisch überlegenen Armen – und die geizigeren Reichen – zu sprechen, ist es lohnenswert, sich dem Phänomen der Charity an sich zu widmen. Warum überhaupt Spenden? Warum wird so positiv übers Spenden gesprochen? Eigentlich ist der Fakt, dass gespendet werden muss, um gesellschaftliche Ungleichheit auszugleichen, doch an sich skandalös. Private Spender*innen und karitative Initiativen füllen die Lücken, die ein dysfunktionaler Sozialstaat hinterlassen hat.
Charity als Feigenblatt
Welche Funktion erfüllt also Charity in einer ungerechten Gesellschaft, in der Geld immer nach oben strömt? In einer Gesellschaft, die genau diejenigen übervorteilt, die sich dann anschliessend als Gönner*innen inszenieren können?
Der Schweizer Unternehmer Beat Curti zum Beispiel ist „an Stiftungen beteiligt und Förderer der Schweizer ‚Tafel‘, wendet sich gleichzeitig aber gegen höhere Steuern“, schreibt die TAZ. Die Geschichte der Charity ist untrennbar verbunden mit dem Gedanken, den eigenen Reichtum zu rechtfertigen. Curtis Vorgehen, eine soziale Institution wie die Tafel zu unterstützen und gleichzeitig gegen höhere Steuern zu lobbyieren, ist keine Ausnahme, sie ist der historisch gewachsene Grund für Charity.
Obwohl es ein internationales Phänomen ist, dass arme Menschen prozentual mehr spenden als Reiche, haben die obersten Prozente einen massiven Anteil am gesamten Spendenvolumen. Ergo gelingt es ihnen, über ihre Spendenbereitschaft, das Bild von rücksichts- und skrupellosen Reichen zur Erzählung von grossherzigen Retter*innen zu konvertieren.
Und das, obwohl viele Reiche Charity nicht nur brauchen, um ihr Image zu transformieren, sondern um hohe Abgaben zu umgehen. So schreibt der Spiegel: „Gutes tun, kann sich auch steuerlich lohnen. Amerikaner können Spenden vom zu versteuernden Einkommen abziehen, und zwar in faktisch unbegrenzter Höhe.“
Das ist in der Schweiz nicht anders, hier dürfen private Haushalte und Firmen bis zu zwanzig Prozent des Reingewinns spenden – Geld, das in der Steuererklärung abgesetzt werden kann. Spenden ist also mitnichten nur ein Projekt grossherziger Reicher, die „etwas zurückgeben wollen“. Oft wird gespendet, um Einfluss zu vergrössern und um Steuern zu sparen. Häufig fliessen Spenden auch direkt an die eigene Familienstiftung.
Neulich wurde ich gefragt, ob ich für einen Abend in einem Wohltätigkeitsklub aus meinem Buch lesen und von meinem Schicksal erzählen wollte. Genau die Klasse, deren Lobbyist*innen eine faire finanzielle Besteuerung ihres Reichtums verhindern, heuchelte Interesse an den Lebensrealitäten der Menschen, deren Not durch ihre Kapitalinteressen überhaupt erst entstanden sind. Ich habe ihnen, dem Lions Club Hamburg-Wandsbek, natürlich nicht geantwortet, denn ich werde mich nicht zum Feigenblatt für ihren Reichtum machen lassen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?