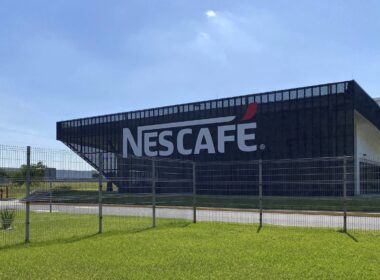Abgebrannte Gemeindeverwaltungen sind die Überbleibsel einer Nacht der Gewalt. Am ersten Augustwochenende versammelten sich während der nächtlichen Ausgangssperre mehrere Hundert aufgebrachte Menschen vor insgesamt vier besetzten Gemeindeverwaltungen mit dem Ziel, diese gewaltsam zu räumen.
Die Polizei sah zu und nahm die Besetzer*innen, Angehörige der indigenen Mapuche, schliesslich fest. Die Menge vor den Rathäusern grölte rassistische Sprechchöre, setzte Autos der Besetzer*innen in Brand und verfolgte fliehende Mapuche. Diese hatten mit ihrer Aktion den inhaftierten machi Celestino Cordóva und 26 weitere Mapuche-Häftlinge unterstützt, die sich zu dem Moment im Hungerstreik befanden, um gegen ihre Haftbedingungen zu demonstrieren.
Brandstifter im Amt
Die chilenische Regierung verurteile am nächsten Morgen die Gewalt „auf beiden Seiten”, zeigte allerdings Verständnis gegenüber „Bürgern, die ihr Rathaus zurückhaben wollen”. Die Rolle der Polizei oder der offene Rassismus der genannten „Bürger*innen” wurden nicht thematisiert. Wieso wurde niemand festgenommen, obwohl doch aufgrund der Corona-Pandemie ab zehn Uhr abends eine nächtliche Ausgangssperre herrscht? Aufgenommene Gespräche beweisen, dass die Polizei von den Vorbereitungen auf die Versammlungen, welche unter der Schirmherrschaft der rechtsextremen Gruppierung APRA Aracaunía stattfanden, wusste.
Die APRA Araucanía besteht hauptsächlich aus Grossgrundbesitzer*innen der gleichnamigen Region. Hier herrscht seit Ewigkeiten ein Konflikt zwischen den indigenen Mapuche, Forstunternehmen und europäischen Siedler*innen. Die Ersteren reklamieren Land für sich, welches derzeit jedoch exklusiv von den Letzteren genutzt wird. Seit Ende der Militärdiktatur 1990 hat keine Regierung den Konflikt zu lösen vermocht, im Gegenteil: Meist wurde die Polizei eingesetzt, um die Proteste der Mapuche im Keim zu ersticken.
Ende Juli dieses Jahres setzte die Regierung Piñera einen neuen Innenminister ein. Der Neue, Víctor Peréz, ist ein Hardliner, kommt aus der Region und ist ein Parteikollege der Sprecherin von APRA Araucanía, Gloria Naveillán. Er besuchte die Region einen Tag vor der nächtlichen Eskalation und machte seinen Standpunkt deutlich: Ohne dass er sich mit Mapuche oder den von den Besetzungen betroffenen Bürgermeistern traf, sprach er von Terrorismus und forderte die unverzügliche Räumung der Rathäuser.
Ein Mord und ein Hungerstreik
Die Beziehungen zwischen den Mapuche und der derzeitigen Regierung waren schon lange auf einem Tiefpunkt. Noch zu Beginn der rechtskonservativen Regierung Sebastián Piñeras im Jahr 2018 lancierte diese eine gross angelegte Übereinkunft für wirtschaftliche Entwicklung und Frieden in der Araucanía. Mit dabei: Mapuche und Unternehmen, welche bislang kaum im Dialog miteinander standen. Die Bestrebungen endeten jedoch abrupt. Am 14. November 2018 tötete die chilenische Polizei den Mapuche Camilo Catrillanca mit einem Schuss in den Rücken, als dieser gerade auf einem Traktor nach Hause fuhr. Angeblich war Catrillanca an einem Autodiebstahl beteiligt. Die Regierung zögerte, sprach zuerst von „legitimer Verteidigung” des Polizisten und brach damit jedes Vertrauen. Die Übereinkunft war Geschichte.
Als Antwort auf das Attentat gründete sich die Bewegung Xawn de Temucuicui. Der Mapuche Eduardo Curin war Teil dieser Bewegung: „Wir sind sofort nach Valparaiso vors Parlament gegangen, haben erreicht, dass die zuständige Polizeieinheit aufgelöst und der Polizist, der den Schuss abgab, identifiziert und angeklagt wurde.” Doch danach bewegte sich nichts mehr. „Seit fast zwei Jahren sind die Ermittlungen am Laufen, und der Mörder wird für die erfüllte Mission mit einem Extra-Gehalt belohnt”, sagt Curin. Nach einem Aufenthalt in Untersuchungshaft veranlasste das Gericht im April 2020 die Überführung des Polizisten in den Hausarrest. Damals stellte sich auch heraus, dass die Polizei ihm weiterhin einen Lohn von 900’000 Pesos im Monat, rund 1’000 Franken, auszahlte. Das ist in etwa doppelt so hoch wie das landesübliche Einstiegsgehalt einer Lehrperson.
„Im Dezember 2018 haben wir uns mit einem Forderungskatalog an die Regierung und das Parlament gewandt”, erzählt Curin. „Wir verlangten die Bildung einer Wahrheitskommission.” Ziel der Kommission wäre es gewesen, die Basis für einen neuen Sozialpakt zu schaffen. Dies wäre der erste Schritt gewesen, um der Militarisierung ein Ende zu setzen und den Landkonflikt zu lösen. Doch dazu kam es nicht. Seit Anfang 2019 herrscht Schweigen zwischen beiden Parteien.
Curin ist aufgebracht; ich rede mit ihm übers Telefon, da Reisen innerhalb Chiles aufgrund der Corona-Pandemie derzeit fast unmöglich ist. Die letzten Ereignisse scheinen auch die Mapuche überrumpelt zu haben. Die Pandemie und die daraus resultierende wirtschaftliche und soziale Krise hatten die öffentliche Aufmerksamkeit in den letzten Monaten monopolisiert.
Die Mapuche, die mehr als hundert Tage im Hungerstreik waren, hatten kaum Öffentlichkeit. Unter ihnen ist der Mediziner – machi – Celestino Cordóva. Das Ziel der Proteste war es, dass der Staat das internationale Übereinkommen endlich durchsetzt.
Der Fall des machi und der inhaftierten Mapuche ist beispielhaft. Sie kämpfen seit Monaten dafür, dass der chilenische Staat das „Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern” der Internationalen Arbeitsorganisation – kurz ILO 169 – einhält. Dieses verpflichtet die unterzeichnenden Länder, die speziellen Rechte und Lebensweisen der indigenen Völker anzuerkennen und zu fördern. Im Fall des machi, einem Mediziner und geistlichen Oberhaupt, bedeutet dies, dass er in Verbindung mit seiner Gemeinschaft sein muss. So wird gefordert, dass er regelmässig in sein Dorf zurückkehren darf, um sich um die Mitglieder zu kümmern und seine Kräfte wieder aufzuladen. Nach über hundert Tagen im Hungerstreik und der Warnung, diesen bis zum Tod fortzuführen, gewährte der Justizminister Hernan Larraín dem machi am 18. August einen Besuch von maximal 30 Stunden in seiner Dorfgemeinschaft.
„Ein Apartheidsregime”
Der Ursprung des Konflikts liegt im 19. Jahrhundert. Mit dem Aufbau des chilenischen Staates wurden autonome Gebiete der Mapuche im Süden durch das Militär erobert. Dies ging einher mit massiven Vertreibungen, Mord und Landraub. Europäische Siedler*innen wurden in die Gebiete gebracht und bildeten die neue Oberschicht der Region. Vicente Painel, Menschenrechtsbeauftragter des indigenen Verbands zur Forschung und Entwicklung der Mapuche (AID), bezeichnet die Beziehung der weissen Oberschicht mit den Mapuche als „Apartheidsregime”, in welchem die Mapuche auf allen Ebenen diskriminiert werden. „Kein einziger Offizier hat einen indigenen Nachnamen, und erst seit 2018 haben wir mit Francisco Huenchumilla den ersten Indigenen im Senat”, sagt Painel. Die Region der Mapuche ist die ärmste Chiles und in der Region selbst sind es wiederum die Mapuche, die am stärksten von Armut betroffen sind. Ländliche Gebiete der Mapuche haben kaum Anschluss an öffentliche Infrastrukturen wie asphaltierte Strassen oder gute Bildung. Die Indigenen leben unter ständiger polizeilicher Kontrolle und Gewalt. „Das sind Ghettos”, fügt Painel hinzu.
Obwohl die verfolgte Strategie bislang nicht zu einem Ende des Konflikts geführt hat, im Gegenteil diesen immer weiter anstachelt, hält die Regierung an ihrer sicherheitspolitischen Reaktion fest. Dabei ist Präsident Sebastián Piñera nicht gerade zimperlich, wenn es um Polizeigewalt geht. Dies zeigte die Repression bei der Protestwelle, die das Land ab Mitte Oktober 2019 erlebte (Das Lamm berichtete). Damals tauchte das Polizeikommando, welches im November 2018 den Mapuche Catrillanca umbrachte, unter anderem Namen, aber mit den gleichen Autos im Zentrum von Santiago auf.
Curin beendet sein Telefonat mit einer Ansage: Eine neue Offensive der Proteste muss her. Unterdessen setzen sich rechte Unternehmerverbände mit der Regierung zusammen. Sie fordern mehr Polizei, mehr Repression und mehr Sicherheit für ihr Eigentum. Die Situation ist ein Interessenkonflikt – ohne Aussicht auf Besserung.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?