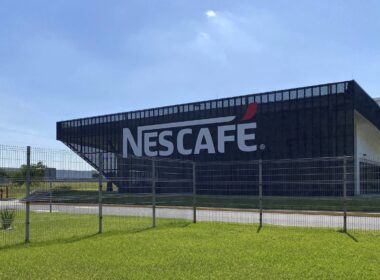Am Abend des 21. Oktober wurde ein guter Freund von mir in der Nähe von Santiago festgenommen. Dies, nachdem er einer durch Schrotkugeln verwundeten Frau geholfen hatte, ins nächste Spital zu kommen. Als er am darauffolgenden Tag freigelassen wurde, war sein Körper übersät mit blauen Flecken, und er humpelte. Über das, was geschehen war, wollte er nicht reden. Nur so viel: „Es war keine angenehme Nacht. Alles, was du dir vorstellen kannst, haben sie gemacht.“
Dieser Fall steht stellvertretend für die Realität eines Landes im Ausnahmezustand, nachdem Proteste gegen die Regierung und das neoliberale Wirtschaftssystem knapp eine Woche angedauert haben. Die Regierung reagierte auf den Aufstand vor allem mit der Kriminalisierung der Protestierenden: Das Militär und die Polizei wurden wie „in einem Kriegszustand“ auf die Bevölkerung losgelassen; das Nationale Institut für Menschenrechte sprach von schweren Menschenrechtsverletzungen, die von den Ordnungsmächten begangen worden seien. Erst am Samstag kündigte der Präsident Sebastian Piñera neben den schon früher angekündigten Reformen, die den Lebensstandard leicht verbessern sollen, den Austausch des Kabinetts an. Viel zu spät. Mittlerweile verlangt die Bevölkerung den Rücktritt der gesamten Regierung und die Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung.
Was ist passiert?
Das ‚chilenische Modell‘, welches während der Diktatur von Augusto Pinochet eingeführt wurde, gilt als das neoliberale Extrem. Während der Diktatur sowie unter den Folgeregierungen wurden so gut wie alle öffentlichen Unternehmen und Güter privatisiert. Dies betrifft sowohl die öffentliche Grundversorgung mit Strom und Wasser als auch die Bildung und das Rentensystem. Mit verheerenden Folgen, wie das Beispiel der Wasserprivatisierung zeigt: In Chile herrscht heute Trockenheit, doch das vorhandene Wasser wird extrem ungerecht verteilt. Während kleine Landwirt*innen keinen Zugang zu Wasser für ihre Felder und Tiere erhalten, sind die Hügel der Grossgrundbesitzer mit saftgrünen Avocadobäumen bedeckt. Ein Grossteil des Wassers wird schon in den Anden von den Minen benutzt. Auch die Arbeitsrechte wurden in Chile massiv beschnitten und die öffentlichen Kontrollorgane fast gänzlich ihrer Zähne beraubt. So gibt es in der Provinz von Aconcagua, in der eine besonders hohe Zahl an Arbeiter*innen in der Landwirtschaft tätig ist, gerade einmal eineinhalb Beamten, um die Einhaltung der Arbeitsgesetze zu kontrollieren. Anfang Oktober meldeten Zeitungen, dass jede 16. Person in Chile unter Depressionen leidet.
Ebenfalls Anfang Oktober wurde in Santiago der Preis eines Tickets für den öffentlichen Verkehr zum dritten Mal innerhalb eines Jahrs um fünf Rappen erhöht. Das war zu viel: Vereinzelte Gruppen, vor allem Schüler*innen, riefen zu Protesten und zum gemeinsamen Überqueren der Drehkreuze an den U‑Bahn-Stationen auf. Die Erhöhung war für sie ein Symbol für den stetigen Anstieg der Lebenskosten bei gleichbleibenden Löhnen. Das Versprechen, dass sich ihr Lebensstandard verbessern würde, hat sich nie erfüllt. Die Regierung versuchte vom ersten Tag an die Proteste zu unterdrücken und lehnte die Forderungen der Demonstrant*innen ab. So sagte die Transportministerin, dass die Schüler*innen kein Recht auf Demonstrationen hätten, da sie gar nicht betroffen seien und kündigte die Sperrung des reduzierten ÖV-Tarifs für alle beteiligten Schüler*innen an. Nach ein paar Tagen waren die wichtigsten U‑Bahn-Stationen von der militarisierten Polizei bewacht und es kam zu den ersten Misshandlungen von Schüler*innen.
Schlachtfeldartige Szenen im Untergrund
Die Reaktion der Behörden brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Am 18. Oktober kam es zu massiven Protesten an fast allen U‑Bahn-Stationen. Schlachtfeldartige Szenen spielten sich ab. Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Schrotgewehre gegen die Demonstrierenden ein, während diese ihrer Wut freien Lauf liessen und mehrere Metrostationen verunstalteten. In der Nacht rief der Präsident den Ausnahmezustand aus und übergab dem Militär die Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen. Seit der Pinochet-Diktatur von 1973 bis 1990 ist es das erste Mal, dass in Santiago das Militär wieder auf die Strasse geht und für ‚Sicherheit‘ sorgt. Das Militär verhängte sodann nächtliche Ausgangssperren.
Für die Protestierenden und grosse Teile der Opposition war das ein Affront. Sie kündigten weitere Proteste und Generalstreiks im ganzen Land an. Diese dauern bis heute an. Die Tage sind geprägt von massiven Demonstrationen. Nachmittags und mit dem Beginn der Ausgangssperre wird die Repression immer stärker, Panzer fahren auf, und es wird mit Schrott und vereinzeilt auch mit Sturmgewehren auf die Demonstrant*innen geschossen. Die Misshandlung von Festgenommenen gehört zur Tagesordnung. Mittlerweile wird untersucht, ob eine der grössten U‑Bahn-Stationen während der ersten Tage der Proteste als Folterzentrum verwendet wurde. Soziale Organisationen und linke Parteien berichten von illegalen Festnahmen.
Laut dem Nationalen Institut für Menschenrechte (INDH) wurden bis Freitagabend 3162 Menschen festgenommen. Die chilenische Ärztekammer sprach indes von 1’183 verwundeten Demonstrant*innen, die allein in Santiago in die Notaufnahmen kamen. Bislang haben mindestens fünf Menschen durch direkte Einwirkungen des Militärs und der Polizei ihr Leben verloren. Die Dunkelziffer ist allerdings gross: Immer wieder werden neue Leichen mit Schusswunden entdeckt, und viele Demonstrant*innen werden vermisst.
Samstagnacht wurde die Ausgangssperre erstmals wieder aufgehoben, was Polizei und Militär nicht daran hinderte, weiterhin Festnahmen und Schüsse auf Demonstrierende zu tätigen. Der Innenminister Andrés Chadwik weigerte sich, jegliche politische Verantwortung für die Geschehnisse der letzten Tage zu übernehmen. Präsident Sebastían Piñera sprach von einem „Kriegszustand“. Mittlerweile entschuldigte er sich für die Worte und meinte, dass „seine Regierung nicht im Stande war, den sozialen Unmut zu erkennen“. Ausserdem kündigte er seine sozialen Reformen an, die vor allem auf höhere Staatsausgaben beruhen.
Von der linken Opposition und sozialen Organisationen werden diese Reformen aber als unzureichend bezeichnet. Etwa die Erhöhung des Mindestlohns von 270’000 auf 350’000 chilenische Pesos: Dies entspricht einer Erhöhung um rund 100 Schweizer Franken, die etwa 4’000’000 Personen betrifft. Das ist rund die Hälfte der lohnarbeitenden Bevölkerung Chiles. Clou der Massnahme ist jedoch, dass die Erhöhung durch Subventionen von Seiten des Staates bezahlt wird – und die Unternehmen folglich nicht direkt betrifft. Die inner- und ausserparlamentarische Opposition fordert viel grundlegendere Reformen sowie den Rückzug des Militärs in die Kasernen.
Der Ruf nach radikaler Veränderung
Es sind radikale Veränderungen, die in den Protesten gefordert werden. Sie sind der Aufschrei einer Bevölkerung, die viel zu lange unter dem neoliberalen Regime gelitten hat. Und so meinte auch die Historikerin Claudia Zapata im Interview mit Telesur, „dass nur eine grundlegende Reform des politischen und wirtschaftlichen Systems die derzeitige Situation beruhigen kann.“ Landesweit gehen weiterhin jeden Tag tausende Chilen*innen auf die Strasse. Allein in Santiago sprachen alternative Medien von mindestens 1’200’000 Menschen, die sich auf dem zentralen Platz versammelten. In der Nacht, während der Ausgangssperre, treffen sich die Menschen vor ihren Häusern und klopfen gemeinsam zum Protest gegen die Regierung auf ihre Töpfe. Häfen, öffentliche Behörden und viele weitere Betriebe stehen still. Wie die nächsten Tage aussehen werden, weiss jedoch noch niemand. Die Regierung hat jede Rücktrittsforderung abgelehnt und berief weitere Reservisten zum Militärdienst ein. Währenddessen versuchen soziale Organisationen weiterhin Proteste zu organisieren und der Unterdrückung durch Folter und Ermordungen entgegenzutreten. Heute Montag positioniert sich die internationale Kommission der UNO in Chile, um die Einhaltung der Menschenrechte zu überprüfen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?