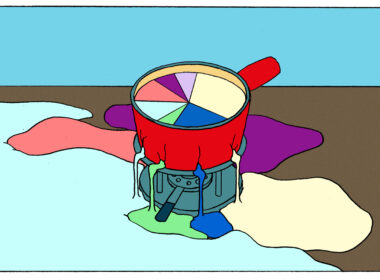Der folgende Text beruht vollständig auf der mündlichen Erzählung Yodits und enthält explizite Passagen zu sexueller Gewalt und Folter. Weitere Informationen zur Situation in den libyschen Gefängnissen finden sich in der Info-Box am Ende dieses Textes.
Yodit ist eine kleine Frau mit einer leisen, hauchenden Stimme. Als sie am 1. September im Nieselregeln vor dreitausend Menschen die Bühne betritt, wird es still. Sie erzählt den Menschen am Ende der Seebrücke-Demo in Zürich ihre Geschichte. Als Yodit die Massenvergewaltigungen durch Wachen in den libyschen Internierungscamps beschreibt, bedient sie sich einer kindlichen Sprache. Die Männer machten Sex mit den Frauen, sagt sie. Zu dritt und zu fünft und die ganze Nacht lang. Sie trügen dabei keine Präservative und wenn die Frauen die brutalen Übergriffe überlebten, dann trügen sie die Spuren nicht nur seelisch davon — HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten grassierten in den Camps. Manche Frauen würden schwanger.
Flucht ist immer gefährlich. Nicht wenige Menschen verlieren auf dem Weg nach Europa ihr Leben. Fast alle Flüchtenden machen Erfahrungen mit Gewalt, Folter, Sklaverei. „Im Gefängnis in Libyen habe ich jeden Tag zu Gott gebetet, dass ich sterben kann. Ich war nicht stark genug, mir selber das Leben zu nehmen wie einige anderen, aber ich wollte so sehr sterben.” Yodit hat überlebt. Seit drei Jahren wohnt sie in der Schweiz in der Nähe Zürichs und verfügt über einen anerkannten Flüchtlingsstatus mit B‑Bewilligung.
Die Geschichte der 28-Jährigen aus Eritrea steht stellvertretend für das Leid, welches im besonderen Frauen auf der Flucht angetan wird und welches in der Diskussion um Menschenrechtsverletzungen oft untergeht: Vergewaltigung und sexuelle Gewalt. „Wenn ich meine Geschichte erzähle, dann ist das eine Therapie”, sagt Yodit, und: „Die meisten Menschen, die hierherkommen, erzählen nur einen Teil der Geschichte oder sie schämen sich zu benennen, was ihnen angetan wurde — vor allem die Frauen. Ich will aber, dass du alles weisst.”
1’600 Dollar bis Libyen
Wir sitzen auf dem kleinen Platz hinter der Autonomen Schule Zürich, als Yodit anfängt zu erzählen. Ihre Geschichte beginnt 2012, als sie das kleine Dorf Degra Libie in Eritrea verliess. Vor den politischen Zuständen und der Diktatur im Land flüchtend, ging sie in den Sudan, wo sie bei einer Familie als „Putzfrau” angestellt wurde. Yodit war im Sudan eine Illegale, ihre Arbeit verrichtete sie schwarz. Die Zustände bei der Familie, die sie wie eine Sklavin behandelte, waren prekär. Als die Frau der Familie Yodit vorwarf, ihren Mann zu verführen, wurde ihr der Lohn verwehrt – der gesamte Lohn von sechs Monaten Arbeit. Yodit floh aus dem Haus und zog in eine Unterkunft mit anderen Eritreerinnen und Eritreern. 45 Menschen waren es, die sich auf engstem Raum arrangierten. „Tagsüber waren alle unterwegs, aber es war immer gefährlich, draussen zu sein. Dass wir wenigstens zusammen schlafen konnten, gab allen etwas Sicherheit”, erzählt sie. Yodit fand einen Lehrer, der ihr etwas Englisch beibringt. Einen Plan hatte sie nicht, ihr Alltag war auf das Überleben ausgerichtet.
Eines Abends, erzählt Yodit, kamen die anderen aus der Unterkunft und sagten, dass sie einen Schlepper gefunden haben, der sie nach Libyen bringen würde. Kostenpunkt: 1’600 Dollar pro Person. Die anderen verliessen die Unterkunft am selben Abend. „Ich hatte eine Stunde Zeit mich zu entscheiden – entweder ich gehe mit, oder ich bleibe alleine hier.” Noch vor der Abreise erhielt Yodit von einer anderen Frau eine Spritze in den Arm, einen starken Hormoncocktail, der eine Schwangerschaft verunmöglichen sollte. „Auf dem Weg nach Libyen wird jede Frau vergewaltigt”, soll Yodits Bekannte gesagt haben, „und wenn nicht auf dem Weg dorthin, dann spätestens in Libyen.”
Drei Wochen, zwei in der Sahara
Yodit kann sich nicht an alle Einzelheiten erinnern. Deswegen schreibt sie alle Erinnerungen nieder, in ein kleines rotes Heft, das sie immer bei sich trägt. Vor allem die Zahlen hat sie sauber beisammen.
In der Gruppe waren neun Frauen. Es waren insgesamt vier Fahrer für zwei Fahrzeuge. Die Männer sprachen Arabisch untereinander, und als die Fahrer eines Abends die Frauen von den Männern der Gruppe trennten, hörte eine der neun Frauen, die Arabisch sprach, unbeobachtet zu und wusste, was sie vorhatten. Die Frauen rannten davon und schrieen um Hilfe, die Jüngste von ihnen war vierzehn. „Wir hatten alle Prellungen von den Schlägen”, erzählt Yodit,„meine waren an den Beinen”.
Yodit stoppt ihre Erzählung. „Wollen wir eine Pause machen?” – „Nein, ich will dir alles erzählen.” Die Szenerie wiederholte sich jede Nacht.

Der ursprüngliche Deal war, dass die Schlepper die Menschengruppe bis in die Sahara bringen, wo andere Schlepper bereits warten sollten, um sie weiter nach Libyen zu bringen. Doch die anderen Fahrer tauchten nicht auf, sie waren, wie Yodit später erfuhr, in einen Konflikt mit bewaffneten Gruppen geraten. Die Gruppe wartete in der Wüste, zwei Wochen lang. Gepackt hatte Yodit für eine viel kürzere Reise. „In dieser Zeit spielte die Gewalt keine Rolle”, erzählt sie. „Wir hatten Hunger und Durst, es gab keinen Schatten und überall war nur Sand, sogar in unseren Augen und Lungen. Es war tagsüber unerträglich heiss und in der Nacht unerträglich kalt.” Die Fahrer hatten noch etwas Wasser, das sie sporadisch an die anderen weiterreichten. Ein toter Mensch kann schliesslich nicht mehr bezahlen. „Wenn ich das erzähle, dann kannst du es dir zwar vorstellen, aber nicht fühlen”, sagt Yodit. „Du hast ein Bild vor Augen, aber ich sehe eine Erinnerung und ich spüre sie.”
Wir machen eine Gesprächspause, Yodit trinkt das Wasserglas, das vor ihr steht, in einem Schluck leer. Ihre Hände zittern stark. „Das ist aber erst seit Libyen so”, sagt sie. „Sie zittern eigentlich immer, egal worum es geht.”
Dreizehn Frauen, zwei Tage. Zweitausend Menschen. Drei Männer.
Nach rund zwei Wochen trafen die libyschen Schlepper in der Wüste ein und verluden die Gruppe wiederum auf zwei Autos. Als sie durch die Wüste fuhren, tauchten aus dem Nichts bewaffnete Gruppen auf. Wer das war, weiss Yodit nicht. Die Bewaffneten schossen auf die zwei Fahrzeuge und trafen eines davon, drei oder vier Personen, hier ist sich Yodit nicht sicher, wurden am Rücken verletzt und in der Wüste zurückgelassen. Als sie in der Nähe von Misrata ankamen, war die Gruppe in Yodits Auto vollständig. In dem anderen fehlten viele Personen, Yodit weiss nicht, was mit ihnen passiert ist. Die Menschen wurden in einem Schweinestall untergebracht, wo sie die 1’600 Dollar übergeben mussten.
Hier bricht Yodits Redefluss ab, sie erinnert sich nur noch bruchstückhaft und bringt Zeit und Ort durcheinander. Der Übersetzer muss immer wieder nachfragen.
Die Soldaten, von denen Yodit nicht mehr weiss, woher sie kamen, ob sie von Anfang an da waren und ob sie überhaupt Soldaten waren, versammelten dreizehn der Frauen, die ihre Schulden bereits bezahlt hatten, in einem abgelegenen Haus nahe der Stallung und vergingen sich an einigen von ihnen. Zwei Tage lang blieb Yodit an diesem Ort, bevor die Frauen von den Soldaten auf einen Bus geladen und in ein Gefängnis gebracht wurden. „Ich bin nicht sicher, ob es ein richtiges Gefängnis war, so wie in der Schweiz. Aber es waren vielleicht zweitausend Menschen dort. Männer, Frauen, alle gemischt.”

In dem Gefängnis gab es keine Toiletten und alles war voller Fäkalien, das Wort spricht sie auf Deutsch aus. „Unsere Kleider waren verklebt, alles stank und alle waren krank.” Einen der Wachen nannten die Insassen in Anlehnung an den gleichnamigen amerikanischen Profi-Wrestler „John Cena”. Er war gross, kräftig und schlug alle, Männer, Frauen, Kinder. „Er benutze Stöcke und Stühle und Eisenstangen.” Sexuelle Gewalt war an der Tagesordnung. „Ich hatte Glück”, sagt Yodit, „ich war immer krank und dann liessen sie mich ein wenig in Ruhe, vielleicht weil sie sich ekelten”. Immer hörte Yodit die Schreie der anderen Frauen und Mädchen. Yodit wollte sterben, sie betete jeden Abend darum, sagt sie.
Yodit stockt. Erst am Ende unseres über zweieinhalbstündigen Gesprächs, als der Übersetzer bereits gegangen ist, kommt Yodit an diesen Punkt in der Erzählung zurück. „Ich kann nicht alles sagen vor ihm”, flüstert sie wie als Entschuldigung. „Einmal von drei, ohne Verhütung. Draussen auf der Strasse neben dem Gefängnis. Sie hielten eine Pistole an meinen Kopf.”
2’000 Dollar bis nach Italien
Ein Journalist der BBC besuchte das Gefängnis, das in Wahrheit ein libysches Flüchtlingslager ist. Er redete mit den Frauen, brachte Yodit unter anderem Imodium und fiebersenkende Mittel und überzeugte schliesslich die Leitung, die kranken Personen an einen anderen Ort zu bringen.
Ein Menschenhändlerring fing die Gruppe während der Überführung ab, erschoss die Fahrer und verschleppte die Frauen. „Sie hatten die Strasse mit Stahlseilen versperrt”, erzählt Yodit, „wir wussten nicht, was passiert”. Eine Frau führte die Menschenhändlergruppe an, sie hatte eine Kalaschnikow und bedrohte die Entführten damit. Wer 2’000 Dollar auf sich hatte, wurde von der Gruppe an den Hafen von Misrata gebracht und in ein Schlauchboot gesetzt. Yodit konnte nicht bezahlen. Selbst wenn sie so viel Geld gehabt hätte, wäre es ihr im Gefängnis abgenommen worden. Sie wurde mit einigen anderen in eine Hütte im Wald gebracht, aus den Fenstern sah man nur Bäume, erinnert sie sich. Yodit wurde von den Menschenhändlern gefoltert. Mit Strom, sagt sie, und macht mit den Fingern eine Bewegung, als würde sie Kabel in die Arterien an ihren Handgelenken einführen.
Yodit hat einen Onkel in Kanada. Dessen Nummer hatte sie auf einem Taschentuch niedergeschrieben und versteckt. Die Menschenhändler kontaktierten Yodits Onkel und er überwies das Geld. Yodit wurde an den Hafen von Misrata gefahren und in ein überladenes Boot gesteckt. Yodit erinnert sich, dass sie irgendwann von einem zivilen Rettungsschiff aufgegriffen wurden. Wie viele Tage sie auf dem Meer war, weiss sie nicht.
Anderthalb Jahre keinen Schlaf
Yodit wurde in ein italienisches Flüchtlingscamp gebracht, wo sie um medizinische Versorgung bettelte. Sie hatte Angst, dass sie in Libyen mit HIV angesteckt worden war. Die medizinische Hilfe wurde ihr verwehrt, man sagte ihr, so ein Test sei nicht üblich und ausserdem teuer. Yodit schaffte es nach Rom und von dort aus am 6. Juli 2015 in die Schweiz. Bei ihrem ersten Interview mit der Grenzpolizei in Biasca bat sie erneut um einen Arzt, dieses Mal wurde ihr der Wunsch erfüllt. Yodit hatte im Gegensatz zu vielen anderen Frauen Glück. Sie hat sich nicht infiziert.
Heute lebt Yodit bei einer Familie in einem grossen Haus in der Region Zürich. Sie lernt Deutsch und sucht gerade eine neue Stelle. Von den Personen, die sie auf der Flucht kennenlernte und mit denen sie den Kontakt aufrechterhalten hatte, konnte niemand in der Schweiz bleiben. „Ich weiss nicht, wo sie sind”, sagt Yodit, „die Facebook-Konten sind nicht mehr aktiv”. Ein Jahr und sechs Monate lang nahm Yodit in der Schweiz Schlaftabletten. Ihr wurde eine Therapeutin in Wetzikon zugewiesen. In der Therapie hat sie vor allem viel gemalt, erzählt sie.
Ich frage Yodit, wie es ihr heute geht. „Ich schlafe wieder”, sagt sie, „manchmal”. Das Schlimmste, erzählt Yodit, sind nicht die Bilder, die sie in ihrem Kopf trägt, sondern die Vorstellung, dass tausende Frauen und Männer weiterhin in den libyschen Gefängnissen festsitzen.
Herzlichen Dank an Mussie Y., der den ersten Teil des Gesprächs mit Yodit von Tigrinya ins Deutsche übersetzt hat.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?