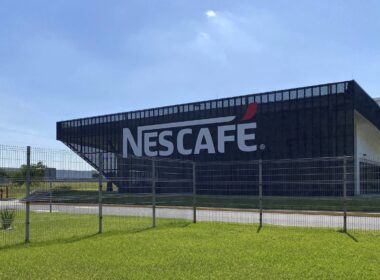Was haben Zürich, Berlin und Santiago de Chile gemeinsam? In allen drei Städten erlebt der Job als Velokurier:in gerade ein starkes Wachstum. Doch ein lang angekündigter internationaler Streik für den 8. Oktober fiel sang- und klanglos ins Wasser.
Während in Berlin und Zürich kaum ein:e Fahrer:in vom Streik mitbekommen hatte, flackerten die Streikparolen von Riders Unidos Ya in Santiago de Chile durchs Internet. Doch passiert ist auch hier nichts. „Wir hatten zwar beschlossen, am 8. Oktober symbolisch zu streiken”, erzählt Juan Pedro Püschel, „haben es aber nicht hingekriegt. Derzeit haben wir nicht die Kraft, einen Streik zu organisieren und wollen nicht noch mehr Konflikt mit unserem Arbeitgeber.”
Der etwa 40-jährige Mann steht zusammen mit seinem etwa 30-jährigen Genossen Daniel Larra in einer lebendigen Einkaufspassage in einem wohlhabenden Zentrumsviertel von Santiago de Chile. Zusammen sind sie im Vorstand der neuen Gewerkschaft Riders Unidos Ya, bestehend aus Fahrer:innen des Lieferdienstes PedidosYa.
Die Gruppe hat sich erst im April im Zuge einer Protestaktion gebildet. Mehrere Fahrer:innen hatten sich spontan organisiert, um gegen das neue Bezahlsystem zu protestieren. Dieses kam einer Lohnreduktion von 40 % gleich. Die Antwort folgte prompt: „PedidosYa ortete per GPS unsere Handys und bestrafte all jene, die an der Protestaktion teilgenommen hatten”, erzählt Püschel. Reduktion der Aufträge und Entlassungen waren die Folge. Seitdem kämpfen sie gegen dieses System der Ausbeutung – mit dem Ziel, auf Dauer in der Firma angestellt zu werden und ein gutes Verhältnis zum Arbeitgeber zu haben.

Ortswechsel, Zürich. Hier gibt es erst gar keine Organisationen wie Riders Unidos Ya. Schon deshalb fiel der Streik am 8. Oktober aus. Patrick, selbst Fahrer und einer der wenigen, die sich gewerkschaftlich organisieren, vermutet, dass es an der hohen Zahl der Nebenjobber:innen liegt: „Die Fahrer:innen wollen schnell ein bisschen Geld verdienen und mit dem Rest nichts zu tun haben”, sagt er.
Trotzdem haben sich in jüngster Zeit auch in Zürich Arbeiter:innen zusammengetan. Auslöser waren auch hier die Massnahmen zu Beginn der Corona-Pandemie. Beim Lieferdienst notime wurde aus hygienischen Gründen auf elektronische Zahlung umgestellt. Über sechs Wochen hinweg konnten keine Trinkgelder kassiert werden. Die Ausfälle wurden nicht ersetzt.
„Mit der fehlenden Kompensation für das Trinkgeld hat es angefangen”, erinnert sich Noël, ein ehemaliger notime-Fahrer. „Wir haben zuerst eine WhatsApp-Gruppe gegründet.” Auf die Anfrage per WhatsApp meldeten sich etwa 20 bis 25 von schweizweit bis zu 270 Fahrer:innen.
„Wir haben einen offenen Brief an die Kolleg:innen und die Firmenleitung geschrieben und darin nochmal die Probleme benannt”, erzählt Noel. Die wichtigsten Punkte: fehlende Kompensation bei den Trinkgeldern, schlechte Kommunikation durch das Management und mangelhafte Ausrüstung der Fahrer:innen mit Equipment wie Regenjacken, Portemonnaies oder Ersatzakkus für das Smartphone.
Probleme mit der Ausrüstung und fehlender Ersatz bei Materialschäden sind es auch, womit die Kolleg:innen in Berlin häufig zu kämpfen haben. Hier müssen die Fahrer:innen wegen der niedrigeren Gehälter manchmal bis zu zehn Stunden am Tag auf dem Velo strampeln. Das setzt Mensch und Material hoher Belastung aus.

Daniel Roddy, Musiker und Kurier beim Food Delivery Service, kann davon ein Lied singen: „Es kommt oft vor, dass an meinem Fahrrad etwas kaputt geht oder die Thai-Suppe im Rucksack ausläuft. Dann müssen wir immer erst nach Hause und der restliche Arbeitstag ist im Eimer.” Ein Verlust, der kaum zu kompensieren ist, denn trotz 35-Stunden-Woche kommt Daniel mit seinem Job nur gerade so über die Runden.
In Berlin gibt es seit Jahren gewerkschaftliche Arbeit im Lieferdienstbereich. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, welche beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB angegliedert ist, und die anarchosyndikalistische Freie Arbeiter:innen Union unterstützen gemeinsam ein Basiskomitee. Doch gewonnene Kämpfe und Mitgliederzuwachs bleiben aus.
Dies zeigt die Geschichte von Daniel. Er trifft sich regelmässig mit 20 weiteren Arbeiter:innen von Lieferando. „Hier haben wir die Möglichkeit, uns gemeinsam an das Unternehmen zu wenden und unsere Beschwerden vorzubringen”, erzählt Daniel. „Wenn man alleine geht, sagen die, man könne sich einfach einen neuen Arbeitsplatz suchen.”
Es ist schwierig, neue Mitglieder zu werben. Wo denn, wenn man den ganzen Tag alleine durch die Stadt fährt? „Wir verteilen hin und wieder Flyer oder versuchen andere Fahrer:innen vor den Restaurants anzusprechen.”
Daniel selber kam auch nur durch Zufall in die Gewerkschaft. Vor ein paar Monaten musste er umziehen und landete in der WG mit einem anderen Kurier. Der Mitbewohner war in einer Gewerkschaft aktiv und lud Daniel ein, mitzumachen. Anders hätte es nicht geklappt. Es gibt zu wenige Treffpunkte, an denen sich die Fahrer:innen gegenseitig kennenlernen könnten.
Der Erfolg lässt auf sich warten. Das Unternehmen reagiert derzeit nicht auf ihre Forderungen. Gewonnene Arbeitskämpfe? – Fehlanzeige.
Auf eigene Gefahr
Weltweit sehen sich Velokurier:innen ähnlichen Problemen gegenüber. Sie vereint insbesondere die Scheinselbstständigkeit, in der sie gefangen sind. Besonders für die Arbeiter:innen in Santiago hat dies fatale Folgen. „Wir haben keine Kranken‑, Unfall- oder Rentenversicherung”, meint Püschel. „Bei einem Unfall sind wir ganz auf uns allein gestellt.” Das Unternehmen kommt weder für den Schaden noch für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit auf. In der Schweiz und in Deutschland sind nach langen, zähen Arbeitskämpfen mittlerweile die meisten Kurier:innen korrekt angestellt. Nur Uber Eats verweigert seinen Angestellten bis heute anständigen Versicherungsschutz.
Auch in Deutschland kommt es regelmässig zu schweren Unfällen. Daniel erzählt: „Als vor einigen Wochen ein Velokurier in Köln starb, trafen wir uns in Berlin mit mehreren Fahrer:innen vor dem Bürogebäude von Lieferando und legten Kerzen nieder.” Der Vorfall hat den Gewerkschafter ins Grübeln gebracht. „Bisher ist mir zum Glück nichts passiert, doch ich entkomme immer wieder nur knapp einem Unfall.”
Eine rosige Zukunft?
Unterdessen wurde das Trinkgeldproblem in Zürich zwar technisch gelöst. Kompensation für die Einnahmeausfälle gab es aber keine. Doch der Brief erregte Aufmerksamkeit. Schweizweit meldeten sich Velokurier:innen. In Zürich kommen sie nun regelmässig zusammen, um sich über Probleme und Massnahmen auszutauschen. Es entstand das Freie-Fahrer*innen-Treffen in Zürich.
Über den Sommer trafen sich die Fahrer:innen einmal im Monat am Oberen Letten. Bei Bier wurden Probleme besprochen und Erfahrungen ausgetauscht – wertvolle persönliche Kontakte, zu denen es im Arbeitsalltag der Velokurier:innen viel zu selten kommt. Patrick kann sich vorstellen, dass in solchen spontanen Zusammenkünften immerhin eine Chance für neues gewerkschaftliches Handeln liegt.

Eine Chance, die unbedingt genutzt werden muss. Denn: „Was wir hier erleben”, ist sich Püschel aus Chile sicher, „ist leider die Arbeit der Zukunft.” Genau deshalb geht es darum, heute für anständige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Püschel und Larra waren bereits im Parlament, wo ein Gesetzesprojekt zur Regularisierung dieser Arbeitsverhältnisse diskutiert wird. In Concepción, einer Hafenstadt im Süden Chiles, urteilte derweil ein Gericht, dass PedidosYa seine Arbeiter:innen fest anstellen muss. Es gibt Hoffnung, doch der Weg ist lang.
Daniel aus Berlin ist bereit, diesen Weg zu gehen. Denn der Job als Velokurier, findet er, könnte durchaus sehr schön sein. Er träumt von besseren Löhnen und einer realen Unterstützung durch das Unternehmen: „Stell dir vor, es gäbe in allen Stadtteilen Werkstätten des Unternehmens. Wenn ich einen Platten habe oder etwas kaputt geht, könnte ich einfach da hingehen, wo ich dann mein Fahrrad repariert bekomme oder einen Ersatz für den Tag erhalte.”
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?