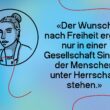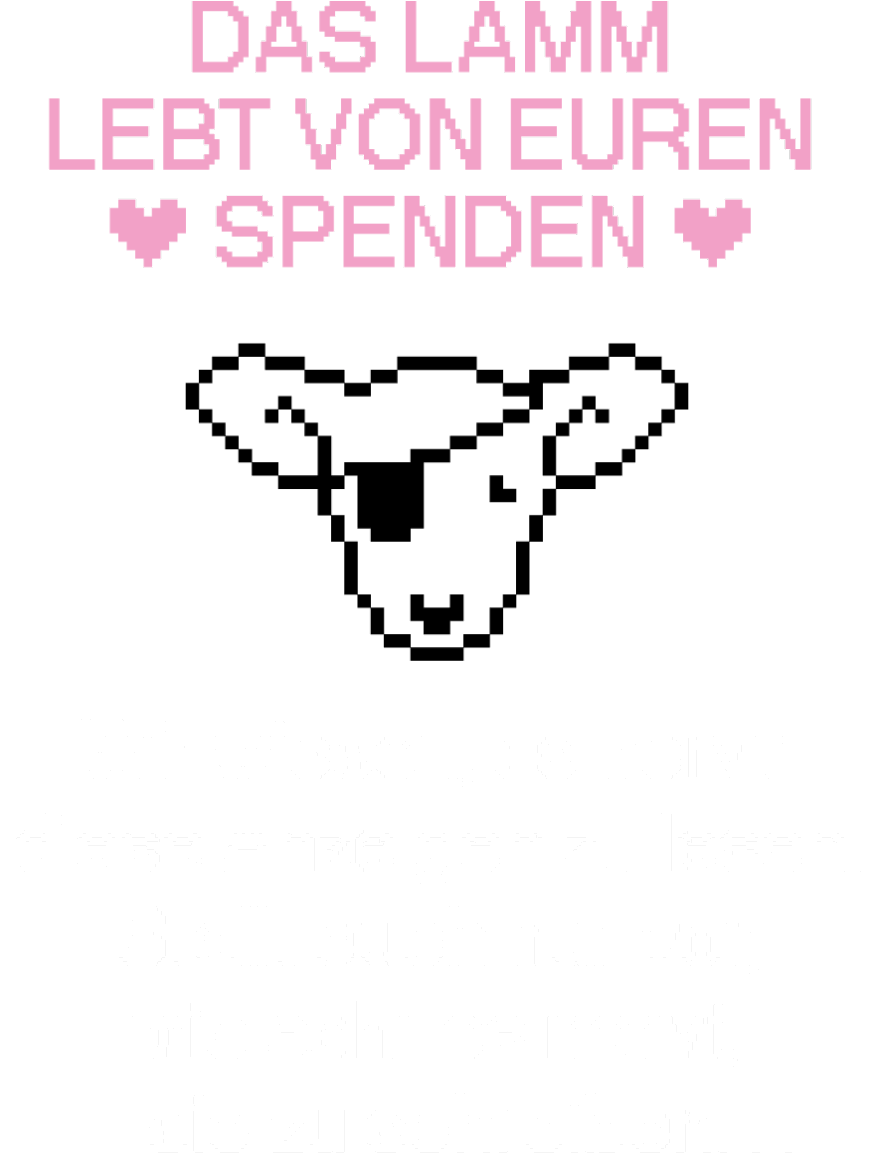Inhaltwarnung: Explizite Wiedergabe von Hassnachrichten, Mord‑, Vergewaltigungs- und Gewaltandrohungen
„Du kleine Muslima und deine Drecksreligion haben in der Schweiz nichts verloren. Euch sollte man alle töten!” Das ist bei weitem nicht die gewalttätigste Nachricht, die die 19-jährige Vera Çelik in den letzten Monaten erhalten hat. Der „Italianbadboy”, wie die E‑Mailadresse des Verfassers lautet, schützt sich wie alle anderen Angreifer durch die Anonymität des Internets. „Du willst mich anzeigen? Viel Spass! Das ist eine geklaute E‑Mailadresse”, beendet der Absender seine Hassnachricht.
Die Aufmerksamkeit der anonymen Gewalttäter zog Çelik zum ersten Mal nach ihrer Teilnahme an der eidgenössischen Jugendsession im Herbst 2024 auf sich. Dort hatte sie, wie andere jugendliche Politiker*innen, eine Wortmeldung gemacht, die sie direkt an ihre „rechtsgesinnten Kollegen” richtet: „Stellt euch vor, ihr putzt fünf Tage die Woche Toiletten für euren Boss und verdient weniger als viertausend Franken.” Mit diesen Worten plädiert die 19-Jährige für höhere Löhne im Care-Sektor.
Als Çelik ihren Auftritt im Internet teilt, verbreiteten Rechtsextreme das Video auf der Plattform X, bedrohen die 19-Jährige mit dem Tod und beschreiben haarklein, welche Gräueltat sie der jungen Frau antuen wollten. „Keine der anderen 300 Teilnehmer*innen musste so etwas erleben”.
Polizei bleibt tatenlos
Ein besonders aufdringlicher User, der unter verschiedenen Varianten des englischen Pseudonyms „Purger” auftritt, schreibt: „Es müsste wieder ein Österreicher kommen und euch in Lager stecken, wie es schon mal passiert ist.” Der Username bedeutet soviel wie „der Säuberer” – und erinnert an den bekannten Horrorfilm „The Purge”, in dem einmal im Jahr sämtliche Gewaltverbrechen straffrei bleiben. Eine Variante seines Pseudonyms ist mit der Zahl „88” versehen – ein rechtsextremer Code für „Heil Hitler”.
Im November 2024 erstattet die Politikerin Vera Çelik erstmals Anzeige gegen den anonymen Täter. Er schickt ihr wiederholt Hassnachrichten, auch an ihre berufliche E‑Mail-Adresse. Eine davon zielt direkt auf ihre religiöse Zugehörigkeit ab: „Was hat so ein Dreckskopftuch in der Schweizer Politik verloren?”
Das unfreiwillige Rampenlicht durch Stefan Büssers SRF-Show verschlimmerte den Hass auf Çelik massiv.
Dennoch erkennt die Polizei in Oerlikon keine Islamophobie in den Hassnachrichten. „Wir sind nicht sicher, ob diese Nachrichten rassistisch sind.” Weil die Polizei den Fall nicht als Rassendiskriminierung einstuft, handelt es sich nicht um ein Offizialdelikt – sprich: Die Strafverfolgung erfolgt nicht automatisch, sondern nur auf ausdrücklichen Antrag der Betroffenen.
Dass der Täter anonym im Internet auftritt, erschwert die Ermittlungen, macht sie aber nicht unmöglich. Rassistische Äusserungen – etwa in Foren oder sozialen Medien – können auch anonym angezeigt werden. Jede Person darf dies tun, auch wenn sie nicht selbst betroffen ist. Eine Recherche von Reflekt zeigt jedoch, dass die Polizei dieses Gesetz oft nicht kennt und geltendes Recht entsprechend falsch anwendet.
Obwohl Vera Çelik als Muslima erkennbar ist und sich ein Teil der Hassnachrichten ausdrücklich gegen ihre religiöse Zugehörigkeit richtet, bleibt ihr Gang zur Polizei ohne Folgen. Nicht erst, aber besonders im aktuellen Kontext des Genozids an den Palästinenser*innen nimmt der Hass auf Muslim*innen spürbar zu – befeuert durch eine mediale Berichterstattung, die den Islam häufig einseitig mit Terrorismus oder Extremismus in Verbindung bringt.
Unfreiwillige Aufmerksamkeit
Manche finden, Vera Çelik müsse als SP-Politikerin in der Öffentlichkeit solche Angriffe hinnehmen. „Aber niemand sollte solchen Hass einfach akzeptieren”, sagt sie.
Im Mai 2025 geriet Çelik unfreiwillig ins Rampenlicht, als Stefan Büsser sie in seiner SRF-Late-Night-Show mit dem als islamistischen Terroristen verkleideten SVP-Politiker Nils Fiechter verglich. Der islamophobe Witz katapultierte sie ins Visier des rechtsextremen Internetmobs. „Ich erhielt Dutzende Morddrohungen”, so Çelik.
Çelik wird nicht nur wegen ihrer Religion, sondern auch als Frau zur Zielscheibe.
Die Verantwortung dafür trage nicht allein das SRF. „Antimuslimischer Rassismus ist ein Problem unserer ganzen Gesellschaft.” Über 500 Beschwerden gingen im Mai bei der Ombudsstelle ein, die den Beitrag als „diskriminierend und menschenwürdeverletzend” einstufte. Das SRF entschuldigte sich nicht und bedauerte lediglich, falls Çeliks „religiöse Gefühle” verletzt worden seien. „Aber darum geht es überhaupt nicht”, so Çelik.
Nach der Ausstrahlung eskalierte die Gewalt gegen Çelik: „Ich werde mit dir machen, was die Hamas mit christlichen Frauen gemacht hat”, schrieb der User „Purger” – und schilderte detailliert, wie er die 19-Jährige vergewaltigen wolle. „Ich warte auf dich … Ich habe dich schon mehrmals in der Stadt gesehen.” Ironisch ergänzt er, er hoffe, sie laufe nicht der rechtsextremen Gruppe Junge Tat in die Hände.
Çelik wird nicht nur wegen ihrer Religion, sondern auch als Frau zur Zielscheibe. Als sie die sexualisierten Drohungen auf TikTok veröffentlichte, sperrte die Plattform nicht den Täter, sondern sie. Der „Purger” meldete ihr Profil – TikTok sperrte es wegen angeblicher „sexueller Belästigung”. „Mit dem Verlust meines Profils gingen viele Beweise verloren”, sagt Çelik.
„Das soll eine Drohung sein?”
Anfang Juni geht Çelik erneut zur Stadtpolizei Zürich, diesmal im Kreis 4. Wieder legt sie die Nachrichten des „Purgers” vor und schildert die letzten Monate. Doch die Polizei nimmt die 19-Jährige nicht ernst. „Haben Sie überhaupt Angst? Sie sehen gar nicht so aus”, zweifelte ein Polizist Çeliks Situation an.
„Bei einem Mann hätten sie sich wohl nicht gewundert, wenn er nicht in Tränen ausgebrochen wäre”, sagt Çelik über die Reaktion des Polizisten. Die Polizei wisse anscheinend nicht viel darüber, wie sich Menschen in traumatischen Situationen verhielten.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Wenn das alles wirklich stimme, sei das eine ernste Situation und sie würden sich den Täter schnappen, habe der Polizist weiter zu ihr gesagt, erinnert sich Çelik. Zwei Stunden lang schilderte sie erneut, was sie in den letzten Wochen ertragen musste.
„Das soll eine Drohung sein?”, fragt der Polizist, nachdem er die Hasstiraden gelesen hat. Für ihn handelt es sich nicht um Morddrohungen, sondern um Ehrverletzung. Letztere ist – im Gegensatz zu Morddrohungen – kein Offizialdelikt und wird nicht automatisch verfolgt, auch nicht bei unbekannten Tätern oder Drohungen im Internet.
Dann liest ein Praktikant eine der Hassnachrichten laut vor: „Ich werde dich zwölf Stunden lang missbrauchen und massakrieren”. Seiner Meinung nach sei das brutal genug, meint der Polizistenanwärter zu seinem Vorgesetzten. Dieser ist sich weiterhin unsicher.
„Massakrieren ist doch ein Synonym für umbringen?”, fragt Çelik die Beamten schliesslich. Das zeigt Wirkung: Die Polizei gestattet ihr endlich, eine Anzeige wegen Morddrohung zu machen. Doch obwohl die junge Muslima mehrmals auf den rassistischen Inhalt der Morddrohungen hinweist, stellt die Polizei auch diesmal keinen Strafantrag wegen Rassendiskriminierung.
„Das schlimmste war, nicht ernst genommen zu werden”
Vera Çelik, Opfer von rechtsextremer Gewalt über die Polizeiarbeit
Im Gegensatz zur ersten Anzeige legt die Polizei Çelik dieses Mal aber ein Dokument zum Unterschreiben vor und beteuert, der Sache nachzugehen. „Da es sich um einen Fake-Account handelt, könnte das aber schwer werden”, habe der Polizist gemeint.
Schutzmassnahmen gab es für die 19-Jährige keine. „Rufen Sie 117 an, wenn etwas passiert”, habe der Polizist Çelik zum Abschied gesagt.
Zur Verfolgung anonymer Hassdrohungen im Netz könnte die Polizei verschiedene Mittel der Strafprozessordnung nutzen: Etwa digitale Spuren wie IP-Adressen oder Inhalte sichern und von Plattformen oder Providern Benutzer- und Verbindungsdaten sowie Geräteinformationen verlangen.
„Sie wollen mich mobben, bis ich mich zurückziehe – aber das werde ich nicht”
„Das schlimmste war, nicht ernst genommen zu werden”, sagt Çelik über die Arbeit der Stadtpolizei Zürich. Selbst wenn die Ermittlungen ins Leere laufen würden – der Zweifel an ihrer Situation sei besonders zermürbend. Selbst das städtische Bedrohungsmanagement, das sich der Prävention zielgerichteter Gewalttaten verpflichtet, habe ihr nicht weiterhelfen können und sie lediglich erneut mit demselben Polizisten telefonisch verbunden.
Dass sich offizielle Stellen der Stadt Zürich, die sich gerne als offen, divers und multikulturell darstellen, so ignorant verhalten, macht der jungen SP-Politikerin Angst.
„Alle ziehen sich aus der Verantwortung”. Die Rechtsextremen wollten offensichtlich, dass sie aufgebe. Aber das liesse sich Çelik nicht gefallen, weder persönlich, noch politisch. „Sie wollen mich mobben, bis ich mich zurückziehe – aber das werde ich nicht”.
Sie fühle sich ohnmächtig und habe alles Mögliche versucht, um Schutz zu finden. „Aber das Justizsystem erlaubt nicht mehr”. Wie sich ihre Situation verschlimmern würde, würde sie politische Mandate ausüben und so noch mehr in der Öffentlichkeit stehen, möchte sich die 19-jährige Muslima gar nicht vorstellen.
Trotzdem habe sie vor, für den Gemeinderat zu kandidieren. „Ich werde erst aufhören, wenn es diese politische Arbeit nicht mehr braucht.”
Auf Anfrage von das Lamm beteuert die Medienstelle der Stadtpolizei Zürich, die „Ermittlungen eingeleitet” und „den Rapport erstellt” zu haben. Angaben dazu, wie ihre Angestellten hinsichtlich der Erkennung von Rassismus geschult werden, oder wie die Polizei sicher geht, dass ihre Beamten relevante Synonyme treffsicher erkennen können, machte die Stadtpolizei nicht. Auch keine Auskunft machte sie darüber, wie ihre Angestellten im Umgang mit und Ermittlung von digitaler Gewalt ausgebildet würden.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?