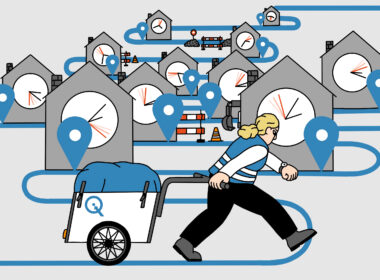Die Gegnerschaft der Erweiterung der Rassismusstrafnorm, das Komitee „Nein zu diesem Zensurgesetz“, das sind grösstenteils Alt- und Jung-SVPlerInnen, ChristInnen, Evangelikale und die halbe Trägerschaft des Marsch fürs Läbe, wie etwa die dubiose Stiftung Zukunft.ch und andere Gruppierungen der Abtreibungsgegnerschaft. Diese ewiggestrige Truppe ist langweilig und ihre immergleichen homophoben Argumente öde. Aber sie sind nicht die Einzigen, die für ein Nein an der Urne weibeln.
„Schwule und Lesben sollten einfach etwas mutiger sein und sich so früh wie möglich outen.“ Das sagt nicht etwa ein hemdsärmeliger SVP-Gemeinderat, sondern Silvan Amberg, ehemaliger Leiter der LGBTI-Gruppe der FDP „Radigal“ und Initiator einer Gruppe für „schwule Offiziere im Schweizer Militär“. Er ist vehement gegen die Erweiterung der Rassismusstrafnorm auf den Schutz sexueller Orientierungen und Identitäten. „Nichts baut Vorurteile so schnell ab wie ein Outing und ein offener Umgang damit. So habe ich damals im Militär so manchen schwulenfeindlichen Spruch entkräftet.“ Es ist eine sehr privilegierte Aussage von diesem gutgestellten, gross gewachsenen Schweizer. Aber er meint es ernst.
Silvan Amberg lehnt sich zurück und nimmt einen Schluck von seinem Espresso. Zum Treffen bei seinem Arbeitgeber PWC in Oerlikon erscheint Amberg im grellen, grob blau-grau karierten Anzug und mit leichtem Jetlag: Er hat gerade eine Woche Karibik-Kreuzfahrt hinter sich.
Es sei ein liberales, marktfreundliches Nein. Ein Nein, das die queere Community aus seiner Sicht unterstützen sollte. Er setze sich für die Ehe für alle und gleiche Rechte für Homosexuelle ein – aber eben für gleiche Rechte, nicht für Sonderrechte, wie Amberg das nennt. Der Enddreissiger ist einer der zwei führenden Köpfe hinter dem Komitee „Nein zum Sonderrecht“.
„Wir wollen gleichwertig akzeptiert und nicht als schwache Minderheit behandelt werden. Für eine Gesellschaft, die Aufklärung betreibt und nicht andere Meinungen bestraft. Wir stehen für eine starke Zivilgesellschaft ein – ohne Behördenwillkür und Gesinnungsterror“, schreibt das Komitee auf seiner Website, die mit zahlreichen Regenbogenfähnchen und geballten Fäusten daherkommt. Rund 20 Personen sind Mitglied des Komitees, die meisten stammen aus der JSVP, kantonalen Gruppierungen der Jungfreisinnigen oder wie Amberg selbst aus der libertären Kleinstpartei Up! Schweiz. Etwa ein Drittel der Komiteemitglieder sind laut Amberg hetero – „aber die sind alle pro LGBT!“, betont er. Trans*-, Inter*- oder non-binäre Personen sind laut Amberg keine im Komitee vertreten.
Alles begann mit einem Tweet
„Zuerst wollten wir von Up! uns gar nicht engagieren. Aber uns war auch bewusst, dass – wenn wir es nicht tun – die Abstimmung auf pro und contra Homosexuelle hinausläuft“, erzählt Amberg. Das „Sonderrechte Nein“-Komitee entstand schliesslich aus einem Twitteraustausch mit Michael Frauchiger von der JSVP. „Wir bringen beide unterschiedliche Positionen ein, die dasselbe Zeil verfolgen. Wir sind beide pro LGBT-Gleichberechtigung, aber gegen diese Redeverbote“, erzählt Amberg. „Frauchigers Fokus als Schwuler ist es, nicht sonderbehandelt zu werden.“ Sein eigener Fokus sei eher die Gewerbe- und Meinungsfreiheit. Dann bringt Amberg das vielzitierte Beispiel vom Bäcker an, der einem schwulen oder lesbischen Paar keine Torte backen möchte: „Es ist auch ein legitime Einstellung zu sagen, ‚ich will mit jemandem nichts zu tun haben und nicht arbeiten‘.“
Wenn Amberg von Gesetzen redet, spricht der Libertäre aus ihm. „Nicht die Erweiterung der Strafnorm ist unnötig, sondern die Rassismusstrafnorm per se gehört abgeschafft.“
Mit diesen Aussagen ist Amberg klar auf Parteikurs von Up! Schweiz. Die Partei mit Sitz in Baar besteht seit 2014 und vereint rund 130 Mitglieder. Das Mutterblatt des Liberalismus, die NZZ, beschreibt die Partei als „sektiererische Kleinstpartei“ und stellt fest: „Mit ihren kompromisslos liberalen Ideen ist sie prinzipientreu bis zur Schmerzgrenze.“ Dazu passen etwa libertäre Plattitüden wie „finanzielle Eingriffe des Staates sind Gewalt, Besteuerung Diebstahl am Individuum“ oder „der magische Feenstaub der Demokratie macht unmoralische Sachen moralisch“. Generell erhält Up! medial aber meist wenig Aufmerksamkeit. Einzig bei der Abstimmung zu NoBillag konnten sie sich kurz und laut in der Öffentlichkeit profilieren. Weiter sorgte eine Veranstaltung von Up! und der der Partei ideologisch nahestehenden Hayek-Gesellschaft mit dem libertären Redner Axel Kaiser im vergangenen Herbst für Schlagzeilen – weil sie von einer Gruppe Vermummter gestürmt worden war.
Obwohl Up! auch dieses Jahr wieder zur Wahl antrat, wird die Partei so schnell keinen Blumentopf gewinnen. Wahlerfolge seien aber, wie Amberg betont, gar nicht im Fokus: „Grundsätzlich möchten wir möglichst viele Menschen von der Idee überzeugen, dass man andere in Ruhe lassen soll. Hierfür müssen wir gar nicht erst an die Macht. Wir haben kein klassisches Wählerziel, sondern ein Überzeugungsziel.“
Andere in Ruhe lassen könnte bedeuten, andere Menschen nicht zu beleidigen, zu bedrohen oder verbal zu schikanieren. Für Amberg bedeutet es jedoch primär freie Marktwirtschaft.
Nicht die PNOS – aber alle anderen kommen in Frage
Das Publikum der Partei sei tendenziell akademisch, jung und theorieinteressiert. Auch viele ehemalige Jungfreisinnige sind dabei, die vom Konformismus der Mutterpartei enttäuscht wurden. „Up! vereint radikale Liberale, Libertäre, Minimalstaatler und Anarchokapitalisten“, erklärt Amberg. Alle also, die gegen staatliche Regelungen und für Freiwilligkeit, die Macht des (finanziell) Stärkeren und Wildwest-Kapitalismus einstehen.
Um sich zu positionieren, geht Up! immer wieder Allianzen ein, meist mit der SVP oder der FDP oder deren Jungparteien, aber laut Amberg sei man flexibel: „Thematisch würde ich mit jeder Partei zusammenarbeiten, ausser vielleicht mit der PNOS.“ Auf die AUNS, das alternative SVP-Gefäss gegen Überfremdung und für eine unabhängige Schweiz, der deutschen AfD ideell sehr nahestehend, ist man aber gut zu sprechen: Christoph Stampfli, der nach einem medienwirksamen Konflikt mit Luzi Stamm aus der AUNS ausgetreten ist, ist aktives Mitglied bei Up! Schweiz. Neutralität und Unabhängigkeit seien Themen, die man bei Up! unterstütze, sagt Amberg, und: „Wenn jemand konservativ leben will, dann soll er das machen. Wir sind dagegen, dass gewisse Gesellschaftsmodelle besonders subventioniert werden.“
Doch zurück zum Diskriminierungsschutz: „Bei uns steht die Selbstbestimmung des Individuums im Vordergrund“, fasst Amberg das Programm zusammen, zu dem eben auch die Positionierung am 9. Februar bestens passt. Keine Menschengruppe sei tendenziell schützenswerter als eine andere. Es ist ein von struktureller Diskriminierung und andauernder Marginalisierung befreiter Ansatz, wie das „Farbenblind“ als Kommentar zur Rassismusdebatte, welches oberflächlich nett daherkommt, unterschiedliche Lebensrealitäten jedoch gerade deswegen verleugnet.
Angesprochen auf Zahlen und Fakten zu der massiven und zunehmenden Gewalt gegen queere Personen meint Amberg: „Das sind ja Individuen, die solche Äusserungen von sich geben.“ Es sei falsch, von einem Mittelwert auf eine Population zu schliessen. „Solange etwas nur eine Aussage ist, darf man nicht mit Gewalt darauf reagieren.“ Gewalt im Sinne von Staatsgewalt, natürlich. Gewalt, und zwar ganz physische und andauernde psychische, ist derweilen für viele Queers in der Schweiz anhaltende Realität.
Roman Heggli von der schwulen Dachorganisation Pink Cross und dem Komitee „Ja zum Schutz“ sieht in Ambergs Haltung etwas, das er als „internalisierte Homophobie“ betitelt. „Dieses Komitee fordert, dass man möglichst normal und konform, unauffällig sein sollte, um akzeptiert zu werden in der Gesellschaft.“ Sie hätten immer wieder mit solchen Stimmen zu tun, die von ihnen Anpassung fordern würden, um mit der Diskriminierung umzugehen. „Aber wir möchten offen leben und auch offen akzeptiert werden – ohne Gewalt und ohne Beleidigungen“, sagt Heggli.
Auch das Argument der Meinungsfreiheit lässt Heggli nicht gelten. Schliesslich habe man in der Schweiz seit 25 Jahren die Rassismusstrafnorm und niemand könne behaupten, in der Schweiz dürfe man nicht sagen, was man möchte. Ausser eben einem: „Hass ist keine Meinung“, so Heggli.
„Weniger Hysterie, mehr Verständnis!“
Silvan Amberg sieht das ganz anders. Die queere Community solle einfach weniger empfindlich und hysterisch sein – und etwas offener für andere Ansichten: „Schwule und Lesben befinden sich oftmals in einer extremen Bubble und können gar nicht mehr verstehen, was jemand irgendwo an einem Stammtisch denkt und wieso er das tut. Das darf nicht passieren, dass diese Diskussion so abgehoben und hysterisch wird.“ Queers sollten etwas mehr Verständnis zeigen für andere, etwa wenn jemand einen Begriff wie „trans*“ falsch gebraucht und „auch wenn mal jemand etwas als schwul bezeichnet, ist das nicht zwingend böse gemeint“.
Offen ist hingegen, ob Queers nicht lange genug Stammtischgelaber hingenommen und ausgehalten haben. Die Frage ist viel eher: Wäre es nicht an all jenen an den Stammtischen, sich toleranter und weniger hysterisch der queeren Bewegung gegenüber zu verhalten?
Was zählt, ist die Redefreiheit und dieselben Ausgangsbedingungen für alle – kein Sonderschutz eben. Hier liegt für Amberg der Unterschied zwischen Gleichberechtigung und der den Libertären so verhassten Gleichstellung: „Gleichberechtigung bedeutet, dass alle gegenüber dem Staat dieselben Rechte haben. Gleichstellung ist, wenn man versucht, in den gesellschaftlichen Prozess einzugreifen und etwas, was man als ungut wahrnimmt, zu beheben.“ Die Regeln müssten fair sein, nicht das Ergebnis. „Da kann es schon mal zu Resultaten kommen, die man individuell als ungerecht wahrnimmt.“ Eine Ansicht von der Sonnenseite des Lebens.
Roman Heggli widerspricht Ambergs Auffassung vehement: „Wir sind als Minderheit viel mehr von Gewalt und Diskriminierung betroffen, deshalb braucht es auch einen spezifischen Schutz. Und die Gesetze haben schlussendlich auch einen grossen Einfluss auf die Gesellschaft und das Zusammenleben. Das hat auch einen grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden: Beispielsweise sehen wir dort, wo die Ehe für alle eingeführt wurde, dass die Suizidalität unter jungen Queers deutlich zurück geht.“
Für Heggli sei das Komitee „Sonderrechte Nein!“ eine Randerscheinung der queeren Community: „Es sind Einzelfiguren, die sich profilieren wollen.“
Silvan Amberg bestätigt, dass das Komitee mit keiner queeren Organisation oder Bewegung in Kontakt gestanden habe – bis auf einen informellen Austausch mit der GaySVP, die sich dem Komitee jedoch nicht angeschlossen habe.
Zum Schluss des Gesprächs wird der sonst durchgehend lächelnde Amberg doch noch kurz etwas wütend. Das Thema ist „linker Gesinnungsterror“, ein Wort, welches sich in den Argumentarien beider Nein-Komitees immer wieder finden lässt. Linke Meinungsdiktatur, das sei in etwa das, was beim Lifestylemagazin für Schwule Display passiert ist. Die Schweizer Aidshilfe hatte gedroht, jegliche Inserate aus dem Magazin abzuziehen, nachdem dieses eine Anzeige des Nein-Komitees abgedruckt hatte. Sowas sei doch moralisch verwerflich und nicht okay. Es sei einfach schädlich, wenn jemand aufgrund einer persönlichen Überzeugung nicht mit jemandem zusammenarbeiten will und zum Boykott aufruft, so Amberg, scheinbar ganz ohne die Ironie hinter seiner Aussage zu bemerken.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!