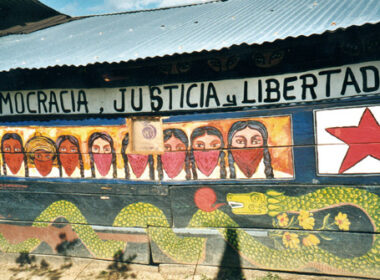Seit das Vordach des Hauptbahnhofs in der Stadt Novi Sad am 1. November 2024 einstürzte, erlebt Serbien anhaltende Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmenden. Bei der Katastrophe von Novi Sad starben 15 Menschen, zahlreiche wurden verletzt. Kurz darauf organisierten Studierende eine spontane Mahnwache, um der Opfer zu gedenken.
Schlägertrupps der regierenden Serbischen Fortschrittspartei, der auch Staatspräsident Aleksandar Vučić angehört, attackierten die Zusammenkunft. Um sich zu solidarisieren, besetzten Universitätsangehörige daraufhin über 60 Fakultäten im ganzen Land und organisierten Proteste. Seitdem gehen in fast allen Städten regelmässig Tausende auf die Strasse.
Die Bahnhofskatastrophe konnte eine solche Massenbewegung auslösen, weil sich an ihr die Probleme des autoritären Systems Aleksandar Vučićs und der unter ihm grassierenden Korruption manifestieren. Es geht um die undurchsichtige Vergabe von Baugenehmigungen, um nicht kontrollierte Sicherheitsvorschriften, um die Art, wie Vučić mit Schlägern Demonstrierende einschüchtern lässt, um Vetternwirtschaft und undemokratische Regierungsmethoden.

Nach mittlerweile 100 Tagen haben sich die Proteste aus den Zentren auch auf ländliche Regionen ausgeweitet, wobei sich viele Bürger*innen mit ihren eigenen Anliegen und Problemen anschliessen. Trotzdem wird in Serbien und auch im Ausland mehrheitlich von Studierendenprotesten gesprochen.
Tara Rukeci Milivojević empfindet das als ein Problem, das letztlich alle Protestziele gefährdet. Sie lebt in Zrenjanin, einer Stadt mit 75.000 Einwohner*innen, früher ein industrielles Zentrum Jugoslawiens, heute geprägt von Arbeitslosigkeit und dem Anblick verfallender Fabriken.
Tara ist Mitglied der Nichtregierungsorganisation Sozialforum Zrenjanin, die aus einer Fabrikbesetzung in den Nullerjahren hervorging. Damals führten Arbeiter*innen ihren Betrieb Jugoremedija erfolgreich in Selbstverwaltung, bis sie nach einigen Jahren von privaten Sicherheitskräften und Polizei gewaltsam vertrieben wurden. Seitdem engagieren sich die verbliebenen Jugoremedija-Arbeiter*innen im Sozialforum Zrenjanin für Gewerkschaftsarbeit und die Rechte der oft prekär arbeitenden Bevölkerung Serbiens.
Das Lamm: Seit 100 Tagen gehen in Serbien täglich Menschen auf die Strasse. Es sind die grössten Proteste seit den Neunzigerjahren, als hunderttausende Demonstrierende Milošević zu Fall brachten. Bist du dabei?
Tara Rukeci Milivojević: Ja, natürlich. Ich gehe regelmässig demonstrieren. Manchmal in Belgrad oder Novi Sad, den beiden grossen Zentren. Oft aber auch hier in Zrenjanin, meiner Heimatstadt in der ländlich geprägten Vojvodina-Region.
Wie laufen die Proteste?
Momentan besteht die Gefahr, dass wir zu viel Zeit und Energie mit, wie ich es nenne, performativen Aktionen verlieren. Wir schaffen tolle Bilder mit Menschenmassen, Transparenten oder kreativen Blockadeaktionen, aber verlieren die Probleme der einfachen Leute aus dem Blick.
Was müsste man besser machen?
Wir sollten versuchen, parallel zu den Demonstrationen gewerkschaftliche Organisation zu fördern, um den Protest in eine echte soziale Bewegung zu überführen. Sonst wird er sich früher oder später verlaufen.

Das klingt etwas ernüchternd. Dabei wurden doch schon einige Forderungen der Protestierenden erfüllt.
Ganz offiziell gibt es vier zentrale Forderungen, die Studierende auf Plena an den besetzten Universitäten beschlossen haben und die auf breiten Konsens stossen. Das sind: die Veröffentlichung von Dokumenten rund um die Bahnhofsrenovierung, die Strafverfolgung der verantwortlichen Politiker*innen, der Rücktritt des serbischen Ministerpräsidenten Miloš Vučević und des Bürgermeisters von Novi Sad und die Strafverfolgung aller Personen, die Demonstrierende angegriffen haben. Zumindest ein paar Unterlagen wurden mittlerweile veröffentlicht, und der Ministerpräsident ist zurückgetreten. Das kann man als Teilerfolg verbuchen.
Das sind recht moderate Forderungen. Zum Beispiel erwähnen sie nicht mal Präsident Aleksandar Vučić, dem man als autoritärem Herrscher die Hauptverantwortung zuschreibt. Lassen sich dafür tatsächlich solche Menschenmassen mobilisieren?
Die sehr engagierten Studierenden prägen das Bild der Demonstrationen. Und das ist auch in Ordnung, denn sie haben mit dem Aufstand begonnen. Aber es verzerrt ein wenig die Realität. Es stimmt, dass es sich um Studierendenproteste handelt. Aber die Studierenden bekommen Unterstützung aus weiten Teilen der Bevölkerung, die ihre ganz eigenen Anliegen mitbringen.
Wie ist dieses verzerrte Bild entstanden?
Es ist Ergebnis einer typisch liberalen Position der wenigen verbliebenen oppositionellen Medien in Serbien. Sie unterstützen den Gedanken von reinen Studierendenprotesten, weil sie tiefgreifende soziale Veränderungen gar nicht wollen. Sie wiederholen endlos diese vier Forderungen der Studierenden. Und das war’s.
Wenn man aber rausgeht, auf die Strasse, und die Leute fragt: Warum protestiert ihr? kriegt man ein ganz anderes Stimmungsbild. Es geht oft um Probleme des alltäglichen Lebens.
Kannst du diese Probleme näher beschreiben? Wie ist die Situation in deiner Heimatstadt Zrenjanin?
Auch hier organisieren Studierende die Proteste. In Zrenjanin haben die Menschen aber noch ganz andere Sorgen, allen voran die Trinkwasserversorgung. Hinzu kommt, dass es kaum noch gute Jobs gibt. Viele müssen nach Belgrad oder Novi Sad zur Arbeit pendeln. Ich glaube, das sind die Hauptgründe, warum Menschen hier auf die Strasse gehen.
Was ist mit dem Trinkwasser?
Das Leitungswasser ist so schlecht, dass schon 2004 offiziell verboten wurde, es zu trinken oder damit Lebensmittel herzustellen. Dreht man den Hahn auf, kommt eine gelbbraune Brühe heraus. Alle Bürger*innen müssen ihr Trinkwasser in Plastikkanistern kaufen.
Unternimmt das Regime etwas gegen die schlechte Versorgung mit Wasser?
Vučić macht immer irgendwelche Versprechen – zuletzt, dass es ab Frühling sauberes Trinkwasser geben wird. Es soll eine Wasseraufbereitungsanlage gebaut werden. Das ist natürlich Bullshit. Sie haben zwanzig Jahre lang nichts getan. Und das gilt nicht nur für Zrenjanin. Es gibt hier in der Region Banat zweiundzwanzig Dörfer, und in jedem einzelnen ist das Leitungswasser unbrauchbar. Überall müssten Aufbereitungsanlagen entstehen. Das wird nicht geschehen.
Wird das auf den Protesten thematisiert?
Leider nicht direkt. Aber ich denke trotzdem, dass die meisten Menschen aus solchen oder ähnlichen Gründen auf die Strasse gehen. Die Demonstrationen werden nur Erfolg haben, wenn wir es schaffen, die vielen verschiedenen Probleme und Anliegen aus den Regionen in unsere Forderungen zu integrieren.
Das Sozialforum Zrenjanin (SFZ) ist eine serbische Nichtregierungsorganisation, die sich für Demokratischen Sozialismus, für Menschenrechte und Minderheitenschutz einsetzt. Es wurde 2014 von ehemaligen Arbeiter*innen der Jugoremedija Fabrik gegründet, die das traditionsreiche jugoslawische Pharmaunternehmen 2003 besetzt und mehrere Jahre erfolgreich in Selbstverwaltung geleitet hatten. Der Staat ging mit privaten Sicherheitsleuten und Polizei gegen die Arbeiter*innen vor und führte einen juristischen Krieg gegen das Selbstverwaltungsmodell, bis es trotz sehr guter Unternehmensdaten unter den ständigen Angriffen zusammenbrach.
Vor diesem Hintergrund steht das SFZ für gewerkschaftliche Organisation und die Rechte der oft prekär beschäftigten Menschen in Serbien ein. Die Mitglieder organisieren Podiumsdiskussion, produzieren Pressematerial und Dokumentarfilme zu politisch linken Themen und engagieren sich bei Aufbau und Neugründung von Gewerkschaftsgruppen.
Für internationales Aufsehen sorgte der Fall der vietnamesischen sogenannten Leiharbeiter auf der Baustelle der chinesischen Firma Linglong Tire, an dessen Aufklärung Tara Rukeci Milivojević und das SFZ mitwirkten. Linglong Tire baut in einer Sonderwirtschaftszone vor den Toren Zrenjanins eines der grössten Reifenwerke Europas, das heute kurz vor der Eröffnung steht. Die beschäftigten Arbeiter*innen wurden grösstenteils über Agenturen aus Vietnam und Indien nach Serbien gebracht und dort in sklavereiähnlichen Verhältnissen festgehalten. Man nahm ihnen die Pässe ab, brachte sie in ehemaligen Schweineställen unter und isolierte sie fast vollständig von der Gesellschaft. Das SFZ konnte mit lokalen Journalist*innen Kontakt zu den Arbeiter*innen aufbauen und die Geschichte ihrer Ausbeutung international bekannt machen.

Als vorläufiger Höhepunkt der aktuellen Protestwelle haben die Studierenden vor zwei Wochen einen Generalstreik ausgerufen. Hat das funktioniert?
Nein, das war kein Generalstreik. Das war eine normale Demonstration. Für einen echten Generalstreik hätte man die Gewerkschaften miteinbeziehen müssen, die organisierte Arbeiterklasse. Das ist nicht geschehen. So wurde der Begriff Generalstreik sinnentleert, und das, wie ich finde, in einem problematischen Moment.
Warum ist das ein Problem?
Wenn von Generalstreik die Rede ist, erwarten die Menschen, dass die Gewerkschaften vorne mit dabei sind. Aber die Gewerkschaften waren in die Vorbereitungen gar nicht eingebunden. Ihre Mitglieder konnten weder dafür noch dagegen stimmen.
Es gab einige Firmen, die sich dem Aufruf anschlossen. Aber von oben herab. Ihre Angestellten durften nicht mitreden. Am Ende mussten sie dann sogar arbeiten, weil es ohne Gewerkschaften kein Streikgeld gab. Die Manager*innen aber konnten es sich leisten und gingen demonstrieren.
Du hast darum auch einmal vom Generalstreik der Manager*innen gesprochen.
Ja. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Denn wenn die Arbeiter*innen wirkliche Gewerkschaftsforderungen stellen, wie zum Beispiel höhere Gehälter oder verkürzte Arbeitszeiten, dann schwenken diese vermeintlich streikenden Manager*innen ganz schnell auf die neoliberal-autoritäre Vučić-Linie ein und bringen die Arbeiter*innen mit den gleichen Mitteln auf Linie.
Welche Mittel sind das?
Allen voran die Agenturarbeit. Das ist ein perfides System der Vučić-Regierung, um Gewerkschaften klein zu halten. Wenn die Menschen in einem Betrieb aufmucken, kündigt man sie und besetzt ihre Stellen mit Arbeiter*innen von sogenannten Arbeitsagenturen. Diese Agenturarbeiter*innen haben keine Rechte und kaum Möglichkeiten, sich zu organisieren. Sie können sich also gar nicht wehren.
Wie geht so etwas vonstatten?
Ein Beispiel unter vielen liefert die Privatisierung von NIS Naftagas, jetzt Gazprom Neft. Noch im laufenden Prozess hat die Firma viele Arbeitnehmer*innen mit normalen Verträgen entlassen. Sie erhielten Abfindungen, wurden aber sofort nach der Kündigung an denselben Arbeitsplätzen innerhalb desselben Unternehmens wieder eingestellt. Diesmal jedoch über Agenturen ohne Verträge. Dadurch wurden ihre Rechte erheblich eingeschränkt und die Kosten ihrer Arbeit gesenkt. Eine Wahlmöglichkeit hatten sie nicht.
Was kann man dagegen tun?
Auch hier gilt: Vergesst neben all den medienwirksamen Protesten die Gewerkschaftsarbeit nicht. Ein Freund von mir hat zum Beispiel geholfen, die erste und einzige Gewerkschaft von Agenturarbeiter*innen zu organisieren. Das war in der Henkel-Fabrik. So müssen wir vorgehen. Dann finden wir zu einem solidarischen Kampf.

Und dennoch geniesst Vučić weiterhin breite Unterstützung besonders in der ländlichen Bevölkerung. Gelingt es ihm auch diesmal, seine Anhänger*innen zu mobilisieren?
Nein. In den vergangenen Tagen hat die Regierung versucht, eine Art Gegenprotest-Rallye durch den Banat zu organisieren. Das ist eine alte Masche: Wenn er in Bedrängnis gerät, veranstaltet Vučić Demonstrationen für sich selbst und lässt die Teilnehmenden mit Bussen aus dem ganzen Land, manchmal sogar aus Bosnien, ankarren.
Vor zwei Jahren, als es schon einmal grosse Proteste gegen das Regime gab, haben wir pro Gegenveranstaltung etwa vier volle Busse gezählt. Aber als sie vor Kurzem in Kikinda, einer Stadt hier im Banat, waren, konnten sie nicht mal einen vollen Bus aufbringen.
Darum ist es eher so: Vučić hat nach wie vor die volle Unterstützung des Staatsapparates, der Institutionen und auch der meisten Medien, aber nicht mehr jene der sogenannten kleinen Leute. Nur noch wenige kommen, um seinen Zirkus zu bejubeln.
Wie könnten Gewerkschaftsarbeit und Studierendenproteste besser verbunden werden?
Es ist eigentlich recht einfach: Viele Studierende müssen ohnehin zusätzlich arbeiten. Besonders in Belgrad und Novi Sad sind die Lebenskosten und Mieten extrem hoch, die Gehälter jedoch sehr niedrig. Darum sind die organisierten Plena auch nicht so demokratisch, wie behauptet wird. Zahlreiche Studierende bleiben allein aufgrund ihrer ökonomischen Situation aussen vor. Sie haben neben der Arbeit gar nicht die Zeit, zu den Plena zu gehen oder auf den Universitätsgeländen zu kampieren. Ich denke, es muss ein demokratischerer Ansatz gefunden werden. Und der Schlüssel dazu liegt bei den Gewerkschaften.
Das heisst?
Die arbeitenden Studierenden sollten sich in Gewerkschaften organisieren und erst danach für einen echten Generalstreik votieren. Dann würden tatsächlich auch die Betriebe miteinbezogen, und relevante Teile der Bevölkerung aus der Arbeiter*innenklasse könnten integriert werden. Umgekehrt sollte sich die Studierendenbewegung wie eine Gewerkschaft organisieren. Gewerkschaften haben eine funktionierende demokratische Struktur, alle können Mitglied sein, wählen, abstimmen, aber müssen nicht die ganze Zeit beim Plenum anwesend sein.
Wird Aleksandar Vučić auch diese Proteste aussitzen können?
Vučić wird nur stürzen, wenn wir eine solidarische Strategie finden, die alle einbindet. Studierende, Arbeiter*innen – organisierte und nicht-organisierte. Ich bin optimistisch, weil es sehr viel Wut gibt, und Wut befeuert die Bewegung, bringt die Leute dazu, sich zu engagieren. Aber ich bin auch besorgt, weil diese wirklich solidarische Bewegung noch nicht existiert. Im Moment handelt es sich um einen grossen spontanen Protest. Jetzt müssen wir nach einer langfristigen Strategie suchen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 24 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1508 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 840 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 408 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?