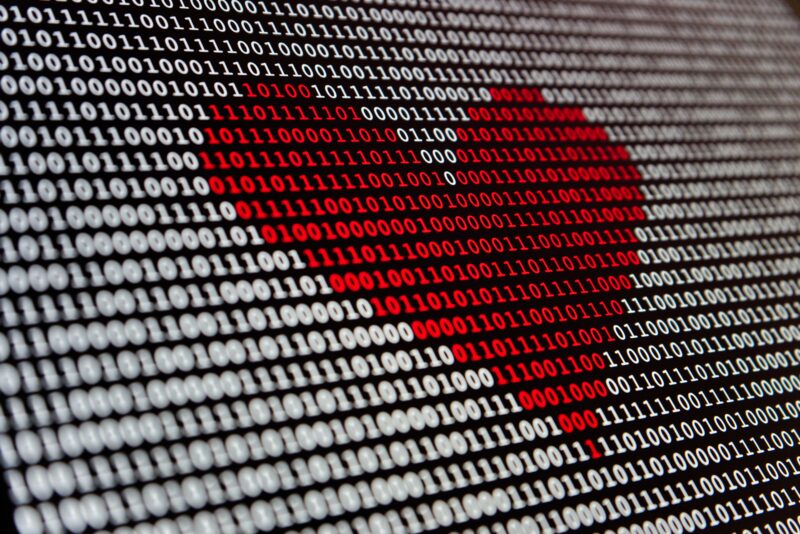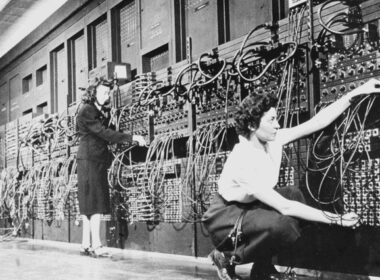Tinder war ein Game-Changer. Als die Mobile-Dating-App 2012 auf den Markt kam, dauerte es keine anderthalb Jahre, bis Swipen, Matchen und Superliken in das kollektive Flirt-Bewusstsein Einzug gehalten hatten.
Online-Dating à la Grindr, OkCupid oder Klassikern wie Parship oder ElitePartner gab es schon vorher, doch Tinder hat es nicht nur geschafft, die internetbasierte Partner:innensuche aus der Ecke der Verzweifelten zu holen, sondern dem Ganzen noch einen sexy Anstrich zu verpassen.
Dating ist kein Mittel zur Partner:innensuche mehr, Dating ist ein Lebensstil. „Game-Changer“ ist dabei buchstäblich zu lesen, denn der spielerische Charakter des Links-rechts-Wischens sorgte dafür, dass sich die App rasend schnell verbreitete. Inzwischen ist die App weltweit über 430 Millionen Mal heruntergeladen worden und hat nach eigenen Angaben für über 60 Milliarden Matches gesorgt.
Doch nicht erst seit uns die gefeierte und oft zitierte Soziologin Eva Illouz mit der Nase darauf stösst, dass sich unsere Emotionalität zwischen Konsumzwang, Digitalisierung und Massenmedien ganz grundsätzlich verändert hat, spüren wir die Kehrseite des Online-Datings auch selbst.
Das ständige (potentielle) Überangebot an romantischen Partner:innen, die Unverbindlichkeit, die fehlende Magie. Und wer sich dem zu entziehen versucht und die Apps einfach löscht, ist nach einigen Wochen oder Monaten wieder zurück. #SingleNotSorry hiess vor kurzem die globale Kampagne von Tinder und gibt dem romantischen Elend wenigstens einen passenden Hashtag à la #yolo.
Ende Mai gaben einige der grössten Dating-Apps bekannt, aktiv die Impfkampagnen der Regierungen unterstützen zu wollen. Mit verschiedenen Anreizen innerhalb der Apps sollen Nutzer:innen von Tinder, Hinge, Bumble und Co., denen die gesundheitlichen Vorteile nicht schon Grund genug sind, zusätzlich ermutigt werden, den Stich zu wagen. Diese reichen von kostenlosen Premiumfunktionen für Geimpfte bis hin zu Services, die das nächstgelegene Impfzentrum ausfindig machen.
In der offiziellen Medienmitteilung von Tinder wird von einem 800%-igen Anstieg des Worts „vaccine“ (Impfstoff) seit Beginn der Pandemie berichtet. Die Impffrage ist offensichtlich ein Thema beim Online-Dating und potentiell „matchentscheidend“.
Mehr als die Hälfte der Generation Z sei sowieso nur daran interessiert, bereits geimpfte Menschen zu daten, heisst es weiter. So können entsprechende Sticker im Profil gewählt werden, um den eigenen Impfstatus auf den ersten Blick ersichtlich zu machen.
Toll für all diejenigen, die ungehinderten Zugang zu einer solchen Gesundheitsversorgung haben, blöd für alle anderen. Egal, ob man noch nicht impfen konnte, es grundsätzlich ablehnt oder einfach diese Angabe nicht öffentlich machen will – vor dem Sticker sind alle gleich.
In dieser Verallgemeinerung liegt ein grundsätzliches Problem der Dating-Apps, wie die Soziologin Jessica Pidoux im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der EPFL in Lausanne herausgefunden hat. Sie beschäftigt sich mit den Mechanismen, mithilfe derer Dating-Apps Leute zusammenbringen, und weist auf die Gefahren hin, die sich mit jedem Swipe akkumulieren, wenn man die Firmen hinter den Plattformen unkontrolliert bestimmen lässt, wie Online-Dating funktioniert.
Das Lamm: Das Thema Partner:innensuche ist so alt wie die Menschheit selbst. Online-Dating ist im Vergleich dazu ein relativ neues Phänomen, oder?
Jessica Pidoux: Nicht unbedingt. Es dreht sich alles ums „Matchmaking“, die Partner:innenvermittlung, und das ist ein altes Prinzip. Studien haben gezeigt, dass es Partner:innenannoncen gab, die so alt waren wie Zeitungen selbst. Man hat auch da ein kurzes Profil erstellt, veröffentlicht und dann gewartet. Die Vermittlerin war die Zeitung und jetzt passiert das eben online. Vor Langem gab es Heiratsvermittler:innen im Dorf, die aufgrund von Infos zur sozialen Schicht, Familie und Ethnie Partner:innen gesucht haben, die zur Familie passten. Das ist auch eine Form des Matchmakings.
Was ist dann neu am Online-Dating?
Viele Konsequenzen ergeben sich aus der Idee der digitalen Plattform und nicht aus einem neuen Dating-Mechanismus: das schiere Volumen an Leuten, die unterschiedlichen Möglichkeiten, Partner:innen zu finden, oder die Geschwindigkeit zum Beispiel.
Die allseits bekannten Auswirkungen der Digitalisierung.
Genau. Und bei der Partner:innensuche hat das konkret zur Folge, dass man sich automatisch weniger engagiert und dazu neigt, kürzere Erfahrungen zu machen. Konstant schwebt das Risiko mit, dass man jemand Besseres finden kann, weil die Optionen immer verfügbar sind.
Was meinst du: Haben wir uns nicht sowieso in diese Richtung entwickelt und die Dating-Apps waren die Antwort darauf? Oder war es umgekehrt und wir sind durch sie teilweise so geworden?
Ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Unser Leben hat sich verändert, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Dinge in unserem täglichen Leben tun. Viele Leute sagen, dass sie keine Zeit haben, auszugehen und neue Leute kennenzulernen. Alle ihre engen Bekannten sind bereits Paare, also haben Dating-Apps alte Wege des Matchmakings aufgegriffen, aber sie haben auch einige neue Elemente hinzugefügt. Die Dating-Erfahrung wird nun durch eine Art Checkliste gemacht.
Aber du untersuchst in deiner Arbeit nicht in erster Linie, wie sich Benutzer:innen verhalten, sondern welche Mechanismen die Apps und Plattformen nutzen?
Mich interessiert, wie Dating-Apps das Matching zustande kommen lassen. Das Projekt bewegt sich interdisziplinär zwischen den Sozialwissenschaften und der Informatik und ist am Institut für Digital Humanities angesiedelt. Das Ziel ist es, genau zu verstehen, wie die Systeme das Matchmaking beeinflussen und wie man wiederum als User:in lernt, online zu daten. Das fliesst dann ja wiederum als Information zurück und beeinflusst den Algorithmus selbst, da wir ihn mit Daten versorgen.
Das Wort Algorithmus schwirrt ja häufig herum und hat schnell einen gefährlichen Beigeschmack. Was für eine Rolle spielt er beim Matchmaking?
Algorithmen arbeiten mit Daten aus dem Benutzerverhalten, aber auch aus Modellen, die diese Daten erzeugen können. Tinder zum Beispiel. Meine Analyse hat ergeben, dass dort ein patriarchales Modell bevorzugt wird, was im Grunde bedeutet, dass jüngeren Frauen mit einer weniger hohen Bildung ein älterer Mann mit hoher Bildung und hohem Gehalt angezeigt wird.
Das ist eine klare Verzerrung. Natürlich ist es statistisch so, dass es in der Gesellschaft diese Tendenz gibt, aber wir haben auch Paare, die nicht so funktionieren. Frauen mit einem hohen Bildungsabschluss werden diskriminiert und damit hört es nicht auf.
Auch was Rassismus betrifft, zeigen die Algorithmen eindeutige Vorurteile. Natürlich ist das diskriminierend, und hinzukommt, dass sich das Modell über die Zeit verstärkt. Die Unternehmen ändern nicht einfach die Algorithmen, um eine Vielfalt herzustellen. Die Algorithmen entstehen aus dem Nutzerverhalten – aber sorgen schliesslich auch dafür, dass es sich bestätigt. Es ist eine Schleife, die sich nun in allen Systemen befindet.
Aber solche Informationen wie Ethnie, Bildung oder Gehalt muss man doch nicht zwangsläufig angeben?
Man hat das Gefühl, man gibt Alter und Standort ein und bekommt dann die entsprechenden Leute in der Reichweite angezeigt. Aber was wirklich dahintersteckt, ist viel komplexer. Die Algorithmen berücksichtigen Facebook-Daten wie zum Beispiel Beliebtheit: Tinder misst, wie viele Likes man für die Bilder dort bekommt. Und auch das Nutzerverhalten in der App selbst spielt eine Rolle. Sie berechnen einen Wert, der auf Attraktivität, Intelligenz und sogar der Nervosität beim Tippen basiert und zeigen dann nur Leute an, die diesem Wert entsprechen.
Wie weit geht das? Wenn ich vegetarische Rezepte google, hören die Apps auf, mir Typen zu zeigen, die Fleisch essen?
Ganz so krass ist es nicht. Die Personalisierung hängt von anderen Menschen ab. Es geht nicht nur um deine Daten, sondern um die Beziehung deiner Daten zu Personen, die dir ähnlich sind. Andernfalls ist die Menge zu klein, um daraus wirklich etwas ablesen zu können. Deine Daten werden aggregiert und zu verallgemeinerten Präferenzen verdichtet.
Also liegt das Problem im Trugschluss vom Verhalten einiger auf das Verhalten aller?
Verallgemeinerung ist ein Grundsatzproblem bei automatischen Systemen. Durch die Kosten für höhere Leistung, Speicherkapazität und Ähnliches liefern sie eher Ergebnisse, die für die meisten funktionieren, nicht für alle Einzelnen. Sie berücksichtigen die Minderheiten nicht.
Gerade bei der Partner:innenwahl ändern sich unsere Präferenzen ja ständig, wir wählen nicht immer gleich. Wenn uns die Apps dann in eine digitale Blase stecken, wie man es von Netflix oder Spotify kennt und ständig die gleiche Art von Filmen und Musik vorgeschlagen bekommt, schränkt das die Partner:innenwahl massiv ein.
Dieses Gefühl begegnet einem doch öfter im Digitalen. Man denkt, alles wäre frei und demokratisch geworden, aber am Ende sitzt man nur in einem neuen, diesmal digitalen Korsett. Übersetzen wir die sozialen Spannungen und Ungleichheiten gerade einfach alle in Daten?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Gender Studies und andere Bereiche weisen immer darauf hin, dass die Gesichtserkennung bei Firmen wie Amazon zum Beispiel Vorurteile hat. Natürlich liegt das einerseits in der Verantwortung des Unternehmens, dass die Technologie anbietet, aber gleichzeitig spiegeln sich darin die Stereotypen und Vorurteile der Gesellschaft wider, die wir bereits haben. Die digitalen Vorurteile ergeben sich aus den von uns zur Verfügung gestellten Daten.
Wäre es eine Lösung, einfach mehr Daten zu erheben, um Minderheiten entsprechend zu repräsentieren und damit Diskriminierung zu unterbinden?
Wir sind dieser Idee erlegen, dass Big Data immer gut ist und je mehr wir haben, desto mehr lernen wir. Aber eigentlich können wir gar nicht alles sammeln, denn die wettbewerbsbedingten Kosten spielen da mit herein. Je mehr Daten man sammelt, desto schwieriger wird es, sie zu verarbeiten und zu speichern.
Das Wirtschaftsprinzip von Dating-Apps basiert darauf, dass unsere Daten gesammelt werden und Geld generieren, indem sie weiterverkauft werden. Die Dating-Industrie und ihre Unternehmen sind inzwischen börsennotiert. Es ist einfacher, die Informationen herunterzukochen und nur Alter, Ausbildung und Arbeit zu erheben, als alles zu sammeln, was eine Person tut.
Und daraus dann aber Muster abzuleiten, wer zu einem passt. Da muss es einen ja fast wundern, dass überhaupt Matches zustande kommen.
Es ist eine sehr traditionelle Sichtweise, dass sich aus Demografie, Alter, Geschlecht, Bildung und Arbeit zuverlässig vorhersagen lässt, wie du dich verhältst. Aber Dating-Apps setzen noch immer darauf, obwohl wir im digitalen Zeitalter tagtäglich viel mehr Dingen, mehr Informationen und anderen Menschen ausgesetzt sind als unseren Familien und dem unmittelbaren Umfeld. Wenn wir diese Modelle nicht überprüfen oder noch schlimmer, wenn wir nicht einmal wissen, wie sie generiert werden und funktionieren, kann das für uns etwas sehr Bedenkliches werden.
Was wäre die eine Sache, die du dazu an Dating-Apps ändern würdest?
Ich glaube nicht, dass es nur eine Änderung der Funktionalitäten braucht. Wir sind gesellschaftlich noch mittendrin, einen Konsens darüber zu finden, was beispielsweise ethische Fragen oder Gleichberechtigung betrifft.
Viele komplexe Themen werden auf das Binäre reduziert, um in ein digitales System integriert zu werden, was eine grosse Veränderung in der Gesellschaft im Allgemeinen darstellt.
Wir brauchen bessere Gesetze, die kontrollieren, was die Unternehmen tun, die das gerade handhaben. Aber dafür muss sich das gesamte System der Online-Wirtschaft ändern.
Unternehmen haben zurzeit die ganze Macht darüber, wie Online-Dating funktioniert. Wissenschaft und Dating-Apps suchen nach Formeln, während unsere individuellen Erfahrungen zeigen, dass Beziehungen viel zu komplex sind, um sie auf eine Formel zu reduzieren.
Dating-Apps standardisieren aber gerade, wie wir eine:n Partner:in bewerten oder wie wir jemanden online verführen. Das schleicht sich auch in unser Offline-Leben ein. Deshalb ist es wirklich wichtig zu wissen, wie User:innen und Entwickler:innen, aber auch die Algorithmen lernen, was die neue Definition von Dating ist.
Dieser Artikel wurde erstmals bei SPEX veröffentlicht.